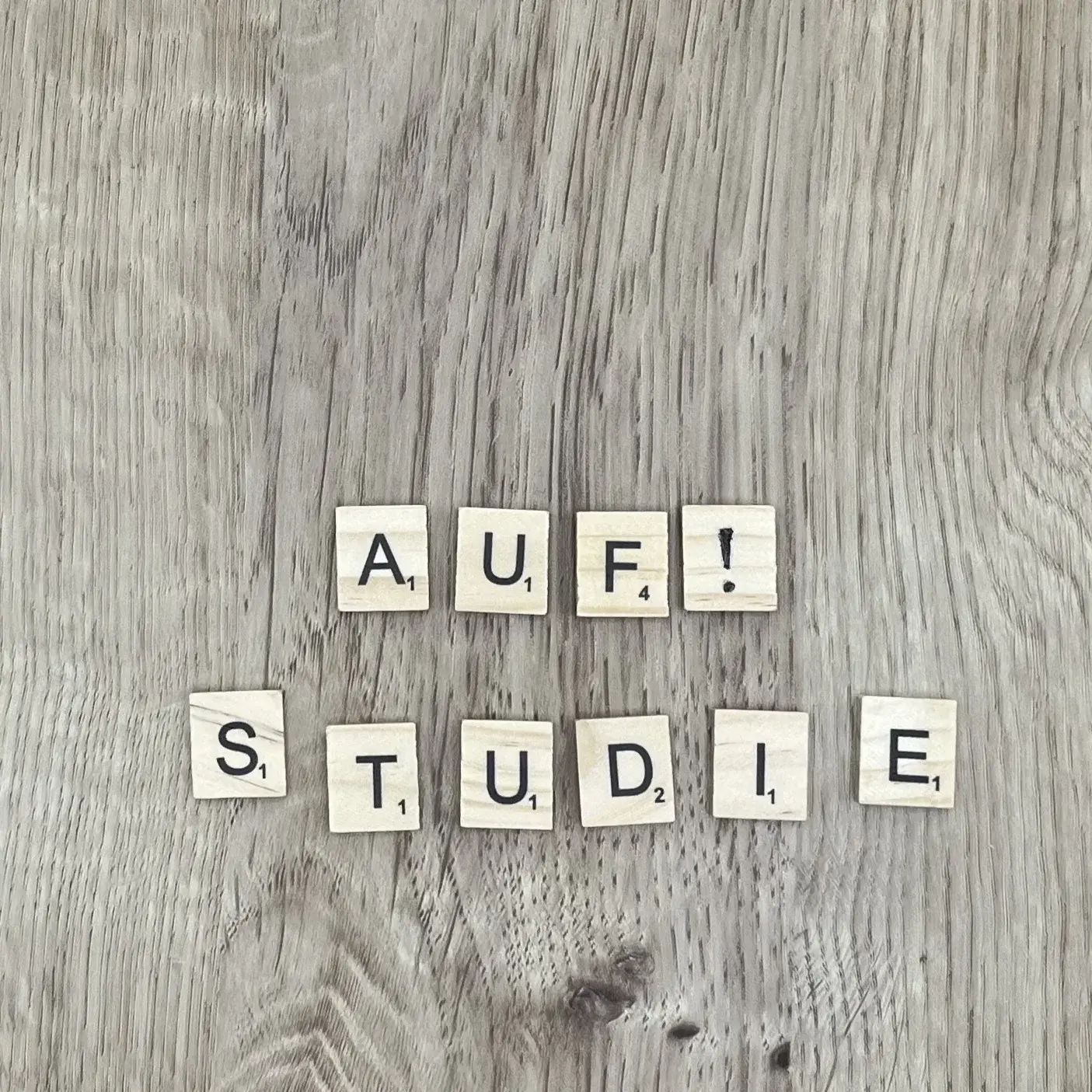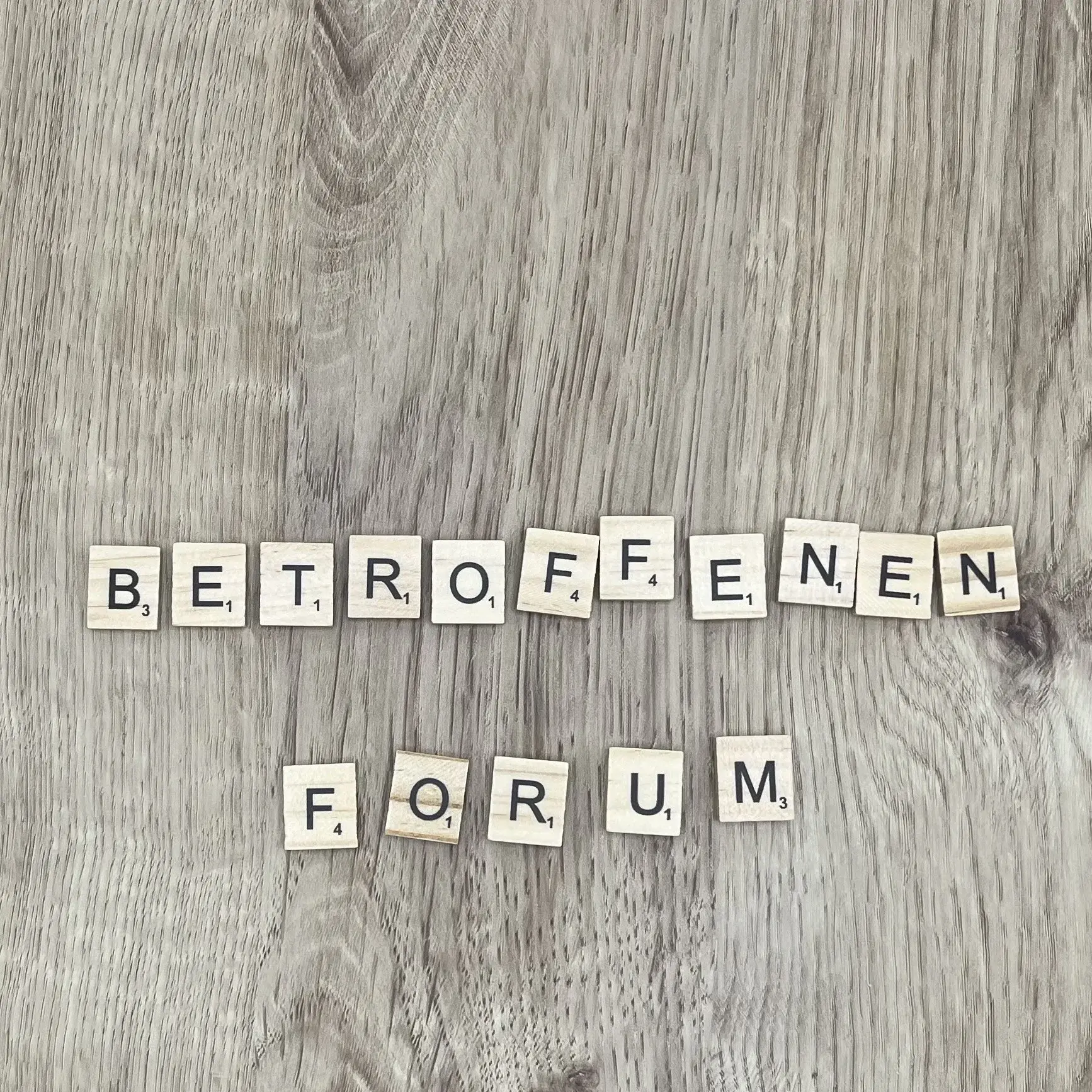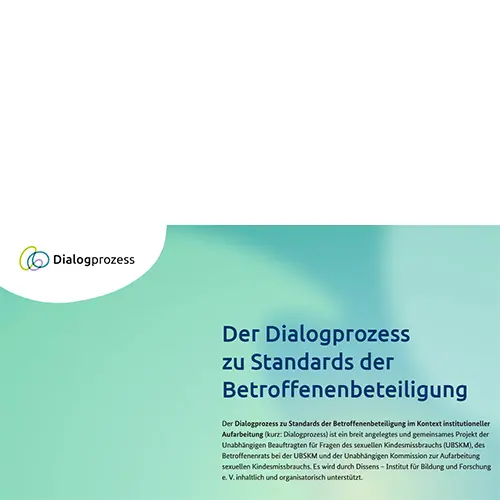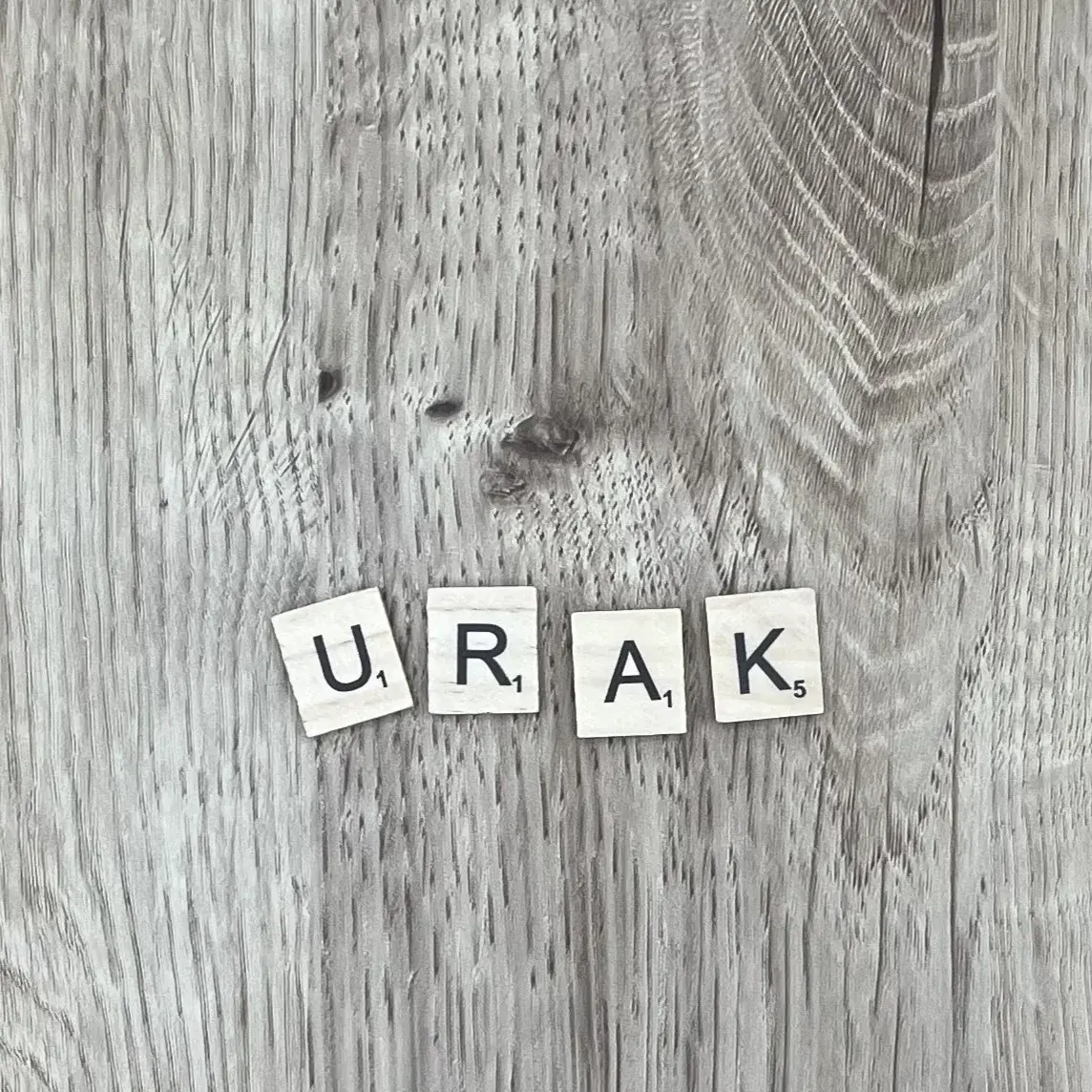Aufarbeitung
Nach dem Bekanntwerden von Gewalt- und Missbrauchsvorwürfen in der katholischen Kirche 2010 und in der Folgezeit meldeten sich auch im Bereich der Evangelischen Landeskirche und Diakonie Menschen, die Opfer von Gewalt und Missbrauch in evangelischen Heimen und Einrichtungen geworden waren.
Im Folgenden finden Sie eine Auswahl von Aufarbeitungsprojekten und Berichten dazu.
Beteiligungsforum sexualisierte Gewalt der EKD und Diakonie
Das Beteiligungsforum Sexualisierte Gewalt in der EKD und Diakonie ist ein bisher einzigartiges Modell der Betroffenenpartizipation. Dort werden alle Fragen, die sexualisierte Gewalt in der evangelischen Kirche und Diakonie betreffen, von Betroffenen gemeinsam mit Beauftragten aus Kirche und Diakonie bearbeitet. Weitere Informationen zum Beteiligungsforum und dessen Mitglieder können direkt hier nachgelesen werden.
Workshop zum Gaststatus für die Betroffenenvertretung im Beteiligungsforum
Die Gruppe der von sexualisierter Gewalt betroffener Personen im Beteiligungsforum lädt zu einem Workshop am 21.03.2026 in Fulda zum Gaststatuts ein. Ziel ist an einer Mitarbeit interessierte Personen über die Möglichkeiten zu informieren. Informationen zur Anmeldung: Gaststatus im Beteiligungsforum – EKD
Landeskirchliche Aufarbeitungsstudie “Auf!”
Die Evangelische Landeskirche in Württemberg hat unter dem Titel “Auf! – Aufarbeitung und Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch in Einrichtungen der Evangelischen Landeskirche in Württemberg 2021” eine Studie beauftragt, die Fälle von Missbrauch in den 1950er und 1960er Jahren im Bereich der Evangelischen Seminare, des Hymnus-Chores und des Esslinger Freizeitgeländes „Dulkhäusle“ untersuchen sollte - mit dem Ziel, aus strukturellen Fehlern der Vergangenheit für Gegenwart und Zukunft zu lernen. Die renommierte Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Ulm führte diese auf drei Jahre angelegte Studie durch. Die Ergebnisse wurden im Rahmen der Herbsttagung der württembergischen Landessynode 2023 der Öffentlichkeit vorgestellt.
Dokumente zum Download
ForuM-Studie
Die unabhängige ForuM-Studie, "Forschung zur Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt und anderen Missbrauchsformen in der Evangelischen Kirche und Diakonie in Deutschland", wurde am 25. Januar 2024 veröffentlicht. Hier finden Sie die Stellungnahmen der Kirchenleitung, eine Zeitleiste zur Aufarbeitung, Intervention und Prävention und einen Abkündigungstext des Landesbischofs für die Kirchengemeinden. Kirchengemeinden finden hier Materialien für die Arbeit vor Ort.
Den Abschlussbericht zur Studie finden Sie hier.
ForuM-Bulletin
Das ForuM-Bulletin der EKD informiert Sie über den aktuellen Stand der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche und Diakonie. Der Newsletter erscheint etwa alle sechs Wochen. Mit ihm bleiben Sie immer informiert, was das Beteiligungsforum beschlossen hat, was sich in den Landeskirchen tut und welche neuen Einsichten gewonnen wurden.
Ein Abonnement können Sie auf der Seite der EKD abschließen: https://www.ekd.de/bulletin-84802.htm
Betroffenenforen der Landeskirche und Diakonie
Die württembergische Landeskirche hat sich bei der Beteiligung von sexualisierter Gewalt Betroffener dafür entschieden, in loser Folge Betroffenenforen zu veranstalten, bei denen Mitglieder der Kirchenleitung mit Betroffenen im Gespräch sind. Diese Foren finden zum Schutz der Privatsphäre unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.
Standards zur Aufarbeitung aus dem Dialogprozess der UBSKM
Über 150 Personen haben sich zwei Jahre lang an diesem Prozess beteiligt – darunter Betroffene sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend, Vertreter*innen von Institutionen sowie unabhängige Aufarbeitungsexpert*innen. Auf Initiative der Unabhängigen Bundesbeauftragten gegen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen (UBSKM), Kerstin Claus, des Betroffenenrates bei der UBSKM und der Unabhängigen Kommission des Bundes zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs haben alle gemeinsam den Praxisleitfaden erarbeitet.
Dieser Praxisleitfaden beschreibt Standards für die Betroffenenbeteiligung bei institutionellen Aufarbeitungsprozessen.
Unabhängige Regionale Aufarbeitungskommission
Die unabhängige Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche und Diakonie tritt in eine neue Phase ein. Unabhängige Regionale Aufarbeitungskommissionen (URAKs) nehmen bundesweit ein Jahr nach der Veröffentlichung der Aufarbeitungsstudie „ForuM“ in den kommenden Wochen ihre Arbeit auf. Insgesamt neun Kommissionen, die in regionalen Verbünden über landeskirchliche Grenzen hinweg errichtet wurden, werden künftig Fälle sexualisierter Gewalt quantitativ erheben, Strukturen analysieren, den Umgang mit betroffenen Personen evaluieren und Kirche und Diakonie zu weiteren notwendigen Maßnahmen beraten. Die Einrichtung der Kommissionen geht zurück auf eine gemeinsame Erklärung zwischen der Unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM), der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der Diakonie Deutschland, unter direkter Mitwirkung des Beteiligungsforum Sexualisierte Gewalt in der EKD. In dieser Erklärung wurde Ende 2023 ein Standard festgelegt, der nun Grundlage für die Arbeit der Kommissionen ist.
Die URAKs setzen sich zusammen aus Betroffenen, Expertinnen und Experten, die gesellschaftliche Verantwortung tragen, sowie Vertreterinnen und Vertretern der Landeskirchen und Landesverbände der Diakonie. Um die Unabhängigkeit der Aufarbeitungskommissionen zu gewährleisten, dürfen nur weniger als die Hälfte der Mitglieder Beschäftigte der evangelischen Kirche oder der Diakonie sein oder einem ihrer Gremien angehören. Die Mitglieder aus dem Kreis der Betroffenen werden durch die Betroffenenvertreterinnen und -vertreter selbst benannt. Externe Experten und Expertinnen werden unabhängig durch die jeweiligen Landesregierungen benannt.
Die württembergische URAK nahm ihre Arbeit am 27. März 2025 auf. Katharina Binder ist deren Geschäftsführerin. Die Kommissionsmitglieder wurden am 28. März im Rahmen der Synodaltagung der Württembergischen Evangelischen Landessynode vorgestellt.
In allen Kommissionen ist die direkte Beteiligung betroffener Personen zentral. Deshalb wurden im Zuge der Vorbereitungen in allen Verbünden betroffene Personen zu einem Forum eingeladen, bei dem über die Kommission und ihre Aufgabe informiert wurde. Aufbauend auf diesem Forum für Betroffene fanden Workshops statt, aus denen dann Betroffenenvertretungen entstanden. Aus den Betroffenenvertretungen werden wiederum Mitglieder in die URAKs entsandt. Diese tragen Informationen zur Arbeit der URAKs direkt wieder ein in die jährlichen Foren für betroffene Personen, die dem Austausch und der Vernetzung dienen.
Weiteres zum Thema:
Unabhängige Aufarbeitungskommission der Bundesregierung Im Auftrag der Unabhängigen Kommission
Im Auftrag der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs erstellte Marlene Kowalski eine Fallanalyse. Basis dieser Analyse sind schriftliche Berichte von Betroffenen an die Kommission sowie vertrauliche Anhörungen. In die Fallanalyse sind insgesamt 65 Fälle eingeflossen.
Am 27. Juni 2018 fand das 3. Öffentliche Hearing der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs statt. Das Hearing widmete sich dem Thema „Kirchen und ihre Verantwortung zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs“.
Kontakt

Ursula Kress
Beauftragte für Chancengleichheit im Evangelischen Oberkirchenrat. Ansprechperson bei sexualisierter Gewalt
Heidehofstraße 20
70184 Stuttgart