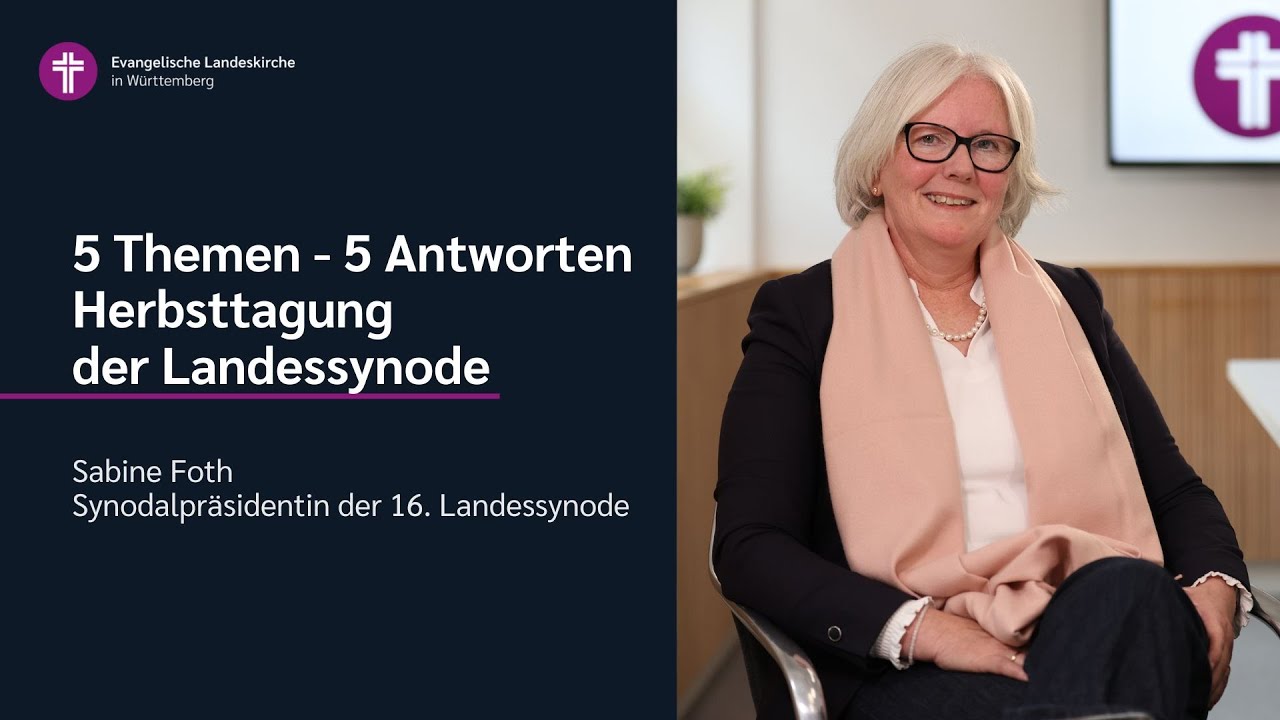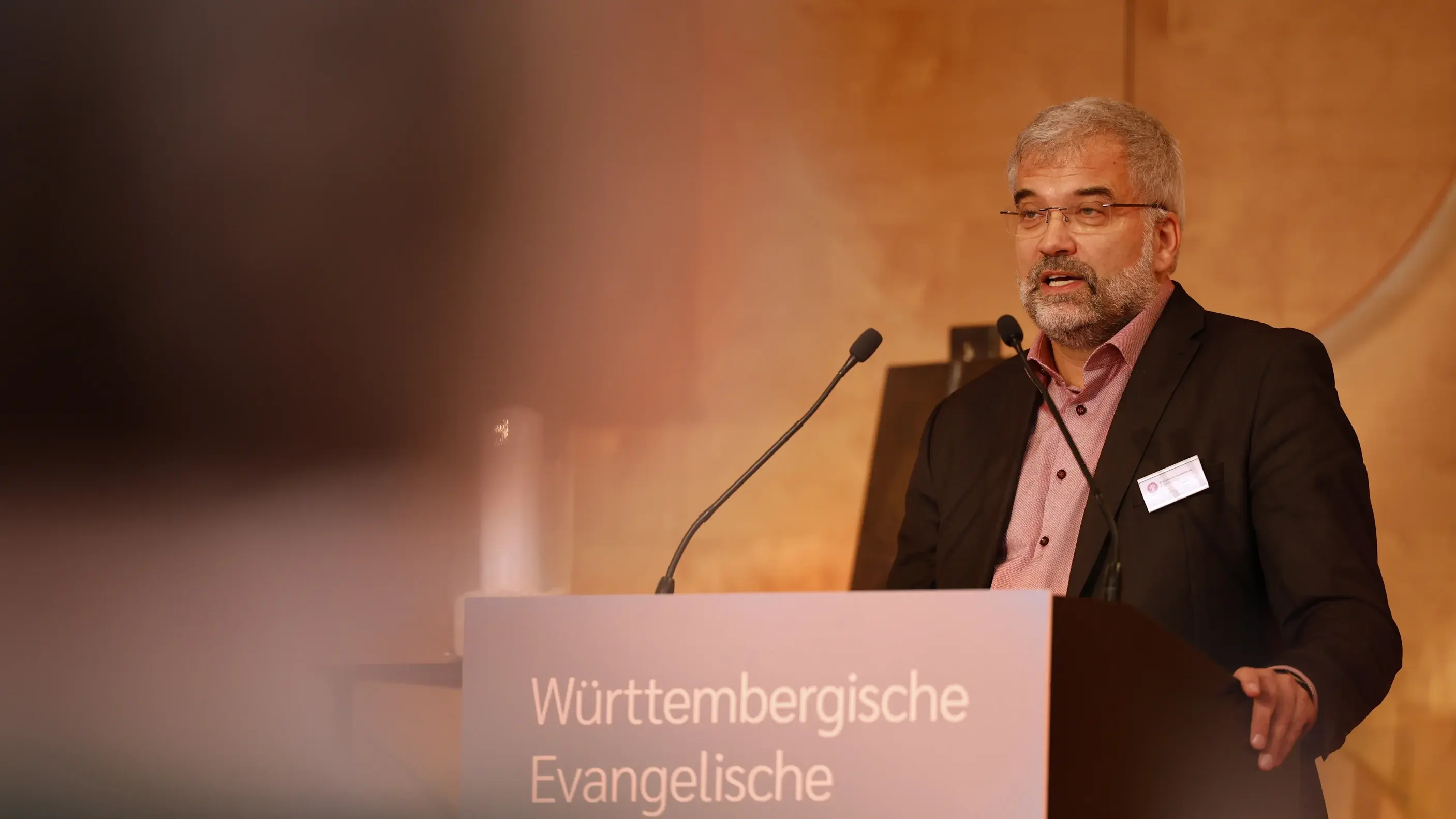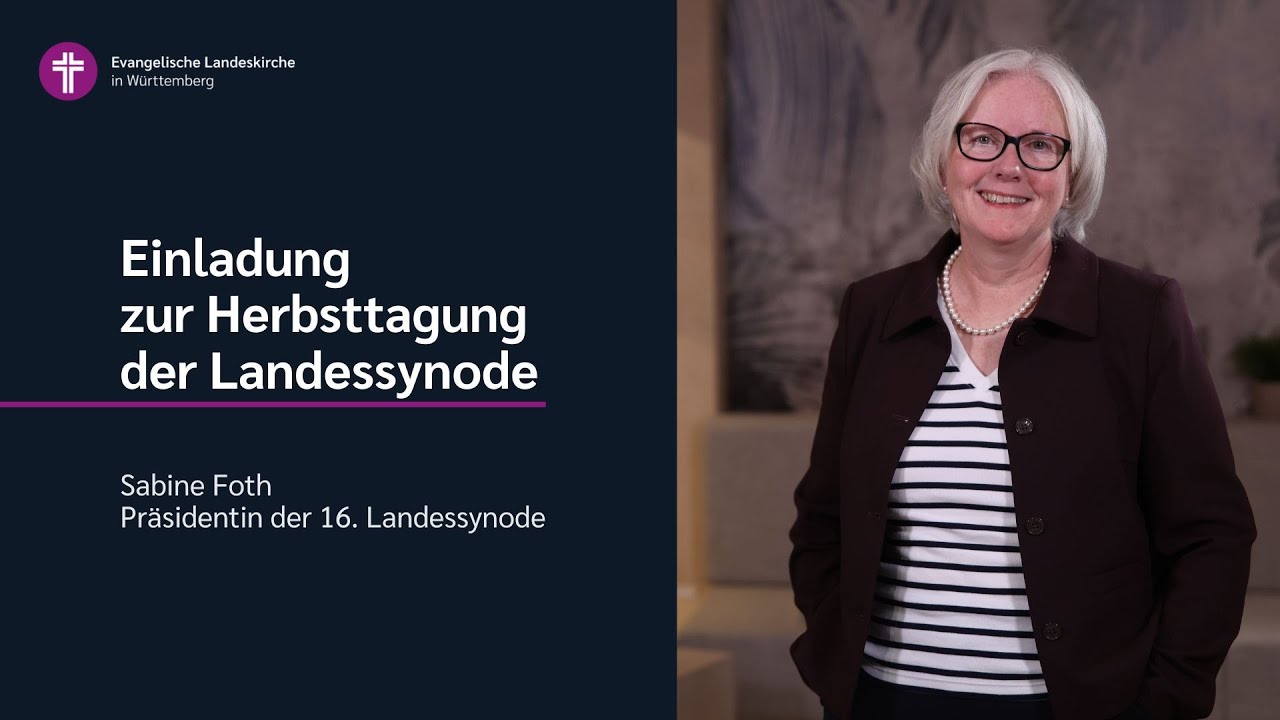Herbsttagung der Landessynode vom 23. bis 25. Oktober 2025
Vom 23. bis 25. Oktober kam die Landessynode im Evangelischen Bildungszentrum Hospitalhof Stuttgart zu ihrer Herbsttagung zusammen. Hier finden Sie alle Dokumente und Berichte zur Tagung.
Alle Themen der Tagung
⬆️ Zum Seitenanfang
✳️Landessynode kompakt: Die wichtigsten Themen im Überblick
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente:
- Grußworte
- Verabschiedung der Unabhängigen Kommission zur Gewährung von Leistungen in Anerkennung des Leids Betroffener sexualisierter Gewalt und Verleihung der Silbernen Brenz-Medaille an den Vorsitzenden Wolfgang Vögele
- TOP 01 Strategische Planung
- TOP 02 Planüberschreitungen und Jahresabschluss der landeskirchlichen Rechnung 2024
TOP 03 1. Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 mit Kirchlichem Gesetz - TOP 04 Trauung gleichgeschlechtlich liebender Ehepaare
- TOP 05
- TOP 06 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung und des Gottesdienstes anlässlich der Eheschließung (Beilage 145)
- TOP 07 Kirchliches Gesetz zur Ablösung des Diakonen- und Diakoninnengesetzes und zur Änderung des Württ. Pfarrergesetzes (Beilage 141)
- TOP 08 Kirchliches Gesetz zur Änderung von Dienstverpflichtungen (Beilage 140)
- TOP 09 Gottesdienstbuch für die Ev. Landeskirche in Württemberg, Zweiter Teil, Teilband Einführungen und Verabschiedungen
- TOP 10 Bericht über die Situation der verfolgten Christen in der Welt sowie der Menschen, die aus religiösen, rassistischen, politischen, ethnischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gründen unter Verfolgung leiden – Schwerpunkt auf Syrien, Kolumbien, Nigeria und Pakistan
- TOP 11 Berichte des Beauftragten für die Entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs und des Islambeauftragten
- TOP 12 Aktuelle Stunde
- TOP 13 Schlussbericht des Ausschusses für Mission, Ökumene und Entwicklung
- TOP 14 Schlussbericht des Finanzausschusses
- TOP 15 Schlussbericht des Ausschusses für Bildung und Jugend
- TOP 16 Änderung des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes
- TOP 17 Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 18 Bericht der Projektstelle für die Themen Rassismus und Antisemitismus/Populismus und Extremismus
- Bildergalerie: Impressionen der Herbsttagung
- TOP 19 Abschaffung der Aktuellen Stunde
- TOP 20 OIKOS und die AKSB
- TOP 21 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (Beilage 142)
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (144)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Kirchengemeindeordnung und weiterer Regelungen (Beilage 143)
- TOP 24 Schlussbericht des Rechtsausschusses
- TOP 25 Selbständige Anträge
- TOP 26 Förmliche Anfragen
- TOP 27 Schlussbericht des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung
- TOP 28 Schlussbericht des Theologischen Ausschusses
- TOP 29 Abschlussbericht des Projekts „Geistlich Leiten, vom Geist geleitet“
- TOP 30 Schlussbericht des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung
- TOP 31 „Raum geben“ - Zwischenbericht zu den Projekten „Aufbruch Quartier“ und „Aufbruch Wohnen“
- TOP 32 Abschlussbericht des Projekts „Zukunftsgutscheine”
- TOP 33 Zwischenbericht zum Fonds „#miteinander“
- TOP 34 Schlussbericht des Ausschusses für Diakonie
- TOP 35 Schlussbericht des Sonderausschusses für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte
- TOP 36 Abschluss der 16. Landessynode
- Gottesdienst mit Abendmahl in der Stiftskirche
Landessynode kompakt: Die wichtigsten Themen und Beschlüsse
Während der dreitägigen Herbsttagung vom 23. bis 25. Oktober standen noch einmal viele Tagesordnungspunkte an. Das waren die wichtigsten Themen und Beschlüsse:
- Umsetzung der Sparmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen
- Gesetz zur Trauung für alle Paare verfehlt knapp die notwendige Zweidrittelmehrheit
- Gesetzliche Änderungen für Diakoninnen und Diakone beschlossen
- Bericht zur weltweiten Situation von verfolgten Christen und anderen Minderheiten
- Ausschluss von Menschen mit extremistischen Einstellungen von kirchlichen Leitungsämtern im Einzelfall erleichtert
- Mehr Begegnung mit Judentum und Islam
- Unabhängige Kommission zur Anerkennung erlittenen Leids verabschiedet
- Abschluss der 16. Landessynode
Sparmaßnahmen beschlossen
Umsetzung der Sparmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen
Die Landessynode hat mit dem Beschluss des Nachtragshaushalts für 2026 die im Sommer festgelegten strukturellen Einsparungen von rund 103,9 Millionen Euro umgesetzt. Die Sparmaßnahmen betreffen die zentralen Dienste, Werke und Einrichtungen sowie den Oberkirchenrat – also die Landeskirche im engeren Sinne. Einleitend erinnerte Oberkirchenrat Dr. Fabian Peters, Leiter des Dezernats für Finanzmanagement und Informationstechnologie, daran, dass die Landessynode sich bei der Sommertagung 2025 intensiv und abschließend mit dem Prozess der Haushaltskonsolidierung und der Versorgungsdeckungsstrategie beschäftigt und die Einsparungen von jährlich 103,9 Millionen Euro im Haushalt der Landeskirche im engeren Sinne auf den Weg gebracht habe. Dabei war eine detaillierte Priorisierungsliste beschlossen worden, die konkret benennt, wo, ab wann und wie viel zu sparen ist. Diese beschlossenen Einsparungen werden nun umgesetzt, soweit sie das Haushaltsjahr 2026 betreffen. Peters hob das „vertrauensvolle, fehlerfreundliche und konstruktive Miteinander“ von Landessynode und Oberkirchenrat hervor: „104 Millionen Euro strukturelle Einsparungen zusätzlich zu den Einsparungen im Pfarrdienst sind keine alltägliche Aufgabe. Dass uns das als Landessynode, als Kollegium und mit den Mitarbeitenden im Oberkirchenrat gelungen ist – und wir uns dabei weiterhin offen und respektvoll in die Augen schauen können – ist für mich ein kleines Wunder.“ Jetzt gelte es „umzusetzen, was die Haushaltspläne sagen“. Der Vorsitzende des Finanzausschusses, Tobias Geiger, erklärte, der Ausschuss habe einstimmig beschlossen, der Landessynode die Zustimmung zum Nachtrag zu empfehlen. Dem kam die Synode durch den Beschluss nach.
Im Zuge der Einsparmaßnahmen standen auch die vier Tagungsstätten der Landeskirche im Fokus: das Evangelisches Bildungszentrum Haus Birkach, die Evangelische Tagungsstätte Bad Boll, die Evangelische Tagungsstätte Stift Urach und die Evangelische Tagungsstätte Bernhäuser Forst. Die Hoffnung, so Geiger, im Tagungsbetrieb auf „eine schwarze Null“ zu kommen, sei im Laufe der Jahre verloren gegangen. Auf Bitte der Synode hatte deshalb der Oberkirchenrat eine Tagungsstättenkonzeption erarbeitet, mit der Vorgabe, bis 2030 zwei der Häuser aufzugeben. Haus Birkach in Stuttgart-Birkach wird zum Ende dieses Jahres geschlossen. Für die dort angesiedelten Bildungseinrichtungen sind alternative Standorte gefunden worden, sodass Haus Birkach verkauft oder vermietet werden kann. Für die Tagungsstätte Bernhäuser Forst in Filderstadt ist eine Übergabe an den CVJM-Gesamtverband Deutschland zum 1. Juni 2026 in Aussicht. Im Gegenzug verpflichte sich der CVJM, die bisherige Nutzung für mindestens zehn Jahre fortzuführen und alle Beschäftigten zu übernehmen. Die Abgabe des Bernhäuser Forst an den CVJM sei für die Landeskirche „der sprichwörtliche Sechser im Lotto“, so Geiger. Das Haus bleibe für die Freizeit- und Tagungsarbeit des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg nutzbar, während der CVJM-Gesamtverband eine entsprechende Expertise mitbringe und neue Belegungsmöglichkeiten erschließen könne. Geiger hob hervor, dass „bei einer Übergabe an den CVJM-Gesamtverband alle Mitarbeitenden ihre Arbeitsplätze“ behalten würden.
Gesetz zur Trauung für alle Paare verfehlt knapp die notwendige Mehrheit
Gesetz zur Trauung für alle Paare verfehlt knapp die notwendige Zweidrittelmehrheit
Ein Gesetzesentwurf, der sowohl die Trauung zwischen Mann und Frau als auch den Gottesdienst anlässlich der Eheschließung zwischen gleichgeschlechtlich Liebenden Trauung genannt und das Verfahren zur Einführung für Kirchengemeinden vereinfacht hätte, scheiterte um vier Stimmen an der notwendigen Zwei-Drittel-Stimmenmehrheit. Er wurde bei 89 abgegebenen Stimmen mit 56 Ja-Stimmen, 31 Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen abgelehnt. Notwendig wären mindestens 60-Ja-Stimmen gewesen. Synodalpräsidentin Sabine Foth sagte dazu: „Als Christinnen und Christen haben wir ein gemeinsames Fundament. Lassen Sie uns das bei aller Enttäuschung nicht vergessen.“
Gesetzliche Änderungen für Diakoninnen und Diakone beschlossen
Gesetzliche Änderungen für Diakoninnen und Diakone beschlossen
Die Landessynode hat mit dem neuen Diakoninnen- und Diakonengesetz das Dienstverständnis des Diakonats geschärft. Zugleich bildet das veränderte Gesetz die Veränderungen ab, die das stark gesellschaftsbezogen arbeitende Diakonat in den letzten Jahrzehnten im Berufsdienst und in der Ausbildung erfahren hat.
Bericht zur weltweiten Situation von verfolgten Christen und anderen Minderheiten
Bericht zur weltweiten Situation von verfolgten Christen und anderen Minderheiten
Kirchenrätin Dr. Christine Keim, Leiterin des Referats für Mission, Ökumene und Entwicklung, berichtete im Rahmen der Herbsttagung der Württembergischen Evangelischen Landessynode über die Situation von Christen und bedrohten Minderheiten weltweit. Zu Beginn gab sie einen Überblick über die kirchlich-diakonische Flüchtlingsarbeit, diese „war und ist in fast allen Kirchenbezirken präsent und hat in den letzten zehn Jahren viele wichtige Projekte initiiert: Angefangen von der Gründung und Begleitung von Asyl-Helferkreisen über die Gewinnung und Schulung von Ehrenamtlichen, die Initiierung von Begegnungscafés, Organisation von Veranstaltungen bis hin zu seelsorgerlicher Begleitung und Empowerment von Geflüchteten.“ Es brauche unter anderem aufgrund der Sparmaßnahmen weiterhin Anstrengungen, „um uns auch künftig als eine ‚flüchtlingsbereite Kirche‘ zu erweisen.“
Ausschluss von Menschen mit extremistischen Einstellungen
Ausschluss von Menschen mit extremistischen Einstellungen von kirchlichen Leitungsämtern im Einzelfall erleichtert
Die Handreichung zur Kirchlichen Wahlordnung ist präzisiert worden, um den Ausschluss von Menschen mit extremistischen Einstellungen von kirchlichen Leitungsämtern im Einzelfall zu erleichtern. Die Änderung betrifft das passive Wahlrecht von Kirchenmitgliedern, zum Verlust führt die Unterstützung kirchenfeindlicher Betätigungen. Diese sind „insbesondere solche, die deshalb im Widerspruch zum Auftrag der Kirche oder zu den Grundsätzen ihrer Ordnung stehen, weil sie die Gottesebenbildlichkeit aller Menschen zum Beispiel durch menschenfeindliche, rassistische, antisemitische oder exklusiv völkisch-nationalistische Äußerungen in Frage stellen“, heißt es nun in der Handreichung. Die Änderung wurde in der Landessynode in ihrer Herbsttagung mit großer Mehrheit beschlossen. Bei der Einzelfallbewertung soll wie bislang der theologische Maßstab entscheidend sein, da die Kirche sich nicht ausschließlich auf Einschätzungen staatlicher Stellen verlassen könne, so der Oberkirchenrat. Anhand von fünf Kriterien muss geprüft werden, ob die betreffende Person als öffentlich auftretender Funktionsträger für eine vom Verfassungsschutz als „gesichert extremistische Bestrebung“ eingestufte Partei in Widerspruch zum Evangelium steht. Je nach Rolle der Person ist zu prüfen, ob diese Person als Wahlbewerberin oder Wahlbewerber für die Wahl zum Kirchengemeinderat oder zur Landessynode durch ihr Verhalten:
- offenkundig und beharrlich Jesus Christus als alleinigen Herrn der Kirche leugnet
- die Verkündigung Christi grob missachtet
- der Ordnung im Zusammenleben der Gemeinde entgegenwirkt und damit ihr Zeugnis unglaubwürdig macht
- als gewähltes oder zugewähltes Mitglied des Kirchengemeinderats oder der Bezirkssynode eine schwere Verfehlung in der Amts- oder Lebensführung begeht
- oder ob sie als Pfarrerin oder Pfarrer einer Vereinigung angehört oder sie auf andere Weise unterstützt, und ob sie dadurch in Widerspruch zu ihrem Amt tritt oder in der Wahrnehmung ihres Dienstes wesentlich behindert wird
- Verfahren zum Ausschluss vom passiven Wahlrecht
Der Beschluss, ein Gemeindeglied nicht in die Wählerliste aufzunehmen, fällt der Kirchengemeinderat. Dieser kann nur getroffen werden, nachdem der Versuch misslungen ist, bei dem Betroffenen Einsicht zu wecken. Dieser Beschluss gilt weiterhin nur für die bevorstehende Wahl. Bei Widerspruch gegen den Beschluss können Visitatoren – also Dekaninnen, Dekane, Prälatinnen oder Prälaten – anderweitig entscheiden und die Aufnahme in die Wählerliste anordnen.
Mehr Begegnung mit Judentum und Islam
Mehr Begegnung mit Judentum und Islam
Pfarrer Jochen Maurer, der Beauftragte für die Entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs der Landeskirchen in Baden und Württemberg, und Pfarrer Dr. Friedmann Eißler, Islambeauftragter der Landeskirchen in Baden und Württemberg gaben auf der Herbsttagung der Landessynode Berichte über die Entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs und über die Beziehungen zum Islam.
Pfarrer Jochen Maurer, der Beauftragte für die Entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs der Landeskirchen in Baden und Württemberg sagte: "Als Kirche, die mit der jüdischen Gemeinschaft wesensmäßig verbunden ist; als Christen, die in einer demokratischen, menschenrechtsorientierten Gesellschaft aktive Mitglieder sind, haben wir hier Verantwortung: Nicht nur in Worten, sondern auch durch überzeugendes Tun." Die Ereignisse des 7. Oktober 2023 ordnete Maurer als tiefe Zäsur ein und bezeichnete die zwei Jahre Krieg in Gaza als „zwei Jahre des Schreckens“ und „Katastrophe für alle, die dort leben“. In Deutschland sehe er eine erfreuliche Entwicklung, sagte Maurer, indem Jüdinnen und Juden als ein wichtiger Teil der Gesellschaft und die jüdische Gemeinde als ein Gegenüber auf Augenhöhe akzeptiert werden. Dennoch plädierte Maurer dafür, Antisemitismus als wichtige Bildungsaufgabe zu begreifen, die nur im Zusammenspiel vieler gesellschaftlicher Träger und Institutionen wirksam angegangen werden könne, und nahm dabei auch die Landeskirche in die Pflicht. Schließlich hätten Christinnen und Christen „eine Lebensbeziehung zu jüdischer Religion, Geschichte und Gemeinschaft – von Anfang an und bis auf den heutigen Tag“.
Im Anschluss gab Pfarrer Dr. Friedmann Eißler, Islambeauftragter der Landeskirchen in Württemberg und Baden, einen Einblick in seine Arbeit seit 2021, aber auch einen Rückblick auf die Aufgabenbereiche der früheren Islambeauftragten. Eißler sagte, Muslimfeindlichkeit sei „ein ernsthaftes Problem in vielerlei Hinsicht, insbesondere was pauschale Urteile über den Islam angeht, was Abwertung und Ablehnung von Menschen aufgrund tatsächlicher oder vermuteter muslimischer Identität, Name und Aussehen angeht, was Stigmatisierung ganzer Gruppen angeht. Und natürlich ist 'Islamismus' ein viele Facetten umfassender Begriff, der differenziert werden muss. [...] Wir wollen Dialog, wir wollen zum guten Miteinander beitragen. Gutes Tun. Zum Segen werden." Wie Maurer begreift Eißler den 7. Oktober 2023 als Einschnitt, in seinem Fall als Zäsur im Dialog mit dem Islam. Anschaulich beschrieb Eißler, wie sich das Verhältnis zwischen Landeskirche und Islam über die Jahre verändert habe. Er nannte die Stichworte Information, Dialog, aber auch den Umgang mit der Radikalisierung. Dabei hob er die „wichtige Begleit- und Aufbauarbeit“ der Kirchen hervor. Eißler forderte die Synodalen auf, die Entwicklungen im Islamismus und islamisch-religiös unterfüttertem Nationalismus wahr und ernst zu nehmen. Dennoch befürworte er den Dialog und das Zutun zum guten Miteinander, um Menschen zu gewinnen und nicht zu verlieren, „in aller Verschiedenheit, in allem Respekt“.
Unabhängige Kommission zur Anerkennung erlittenen Leids verabschiedet
Unabhängige Kommission zur Anerkennung erlittenen Leids verabschiedet
Die Mitglieder der Unabhängigen Kommission zur Anerkennung erlittenen Leides in Landeskirche und Diakonie sind im Rahmen des ersten Sitzungstages der Herbsttagung der 16. Landessynode aus ihrer Tätigkeit verabschiedet worden. Die bisherige Kommission beendet damit nun nach über 10 Jahren ihre Arbeit. Synodalpräsidentin Sabine Foth dankte den Mitgliedern der Unabhängigen Kommission im Namen der Landessynode für ihr wichtiges Engagement. Das System der bisher pauschal zuerkannten Anerkennungsleistungen in der Landeskirche Württemberg wird ab Januar 2026 von einer neuen, EKD-weiten Richtlinie abgelöst, die neben dem Sockelbetrag in Höhe von 15.000 Euro bei strafrechtlich relevanten Taten dann auch individuelle Leistungen gewährt.
Die Unabhängige Kommission nahm 2014 ihre Arbeit auf. Von Anfang an gehörte ihr Wolfgang Vögele, Jurist und ehemaliger Richter einer großen Jugendstrafkammer am Landgericht Stuttgart, als Vorsitzender an. Weitere Mitglieder waren Marie-Louise Stöger, die Geschäftsführerin und Leiterin der Fachberatungsstelle Wildwasser Stuttgart e.V. sowie Hans Fischer, Diakon und ehemaliger Leiter von Jugendhilfeeinrichtungen der Diakonie. Nach dem Tod von Stöger im Jahr 2020 folgten Martina Huck von Wildwasser und an ihrer Stelle 2023 Katja Leonhardt, die ebenfalls Traumatherapeutin ist. Die Unabhängige Kommission hat bisher (Stand September 2025) 221 Anträge bearbeitet: In 200 Fällen hat sie Betroffenen von sexualisierter Gewalt sogenannte Anerkennungsleistungen, ergänzende Hilfeleistungen und Therapiekosten in Höhe von über 4,5 Millionen Euro zugesprochen. Wenige Anträge sind abgelehnt worden und 16 Anträge sind zuständigkeitshalber weiter verwiesen worden.
Die neue EKD-weite Regelung wird die neue Kommission umsetzen. Sie besteht aus Thomas Dörr, Präsident des Landgerichts a.D., Ravensburg und Ulm, Prof. Dr. Birgit Meyer, Politikwissenschaftlerin, Hochschule in Esslingen, sowie Stephen Church, Dipl.-Psych., Traumatherapeut und ehemaliger Fachberater in der Jugendhilfe. Die Mitglieder werden im Rahmen der Sommertagung der 17. Landessynode vorgestellt werden.
Alle neuen Kommissionen sind unabhängig besetzt, wie es in der Landeskirche und ihrer Diakonie in Württemberg von Anfang an war. Die Mitglieder werden durch die Leitungen der jeweiligen Verbünde berufen, arbeiten ehrenamtlich und sind externe Expertinnen und Experten aus verschiedenen Bereichen. Mindestens ein Mitglied muss die Befähigung zum Richteramt haben. Die Mitglieder dürfen nicht bei Kirche oder Diakonie beschäftigt sein. Mit der neuen Richtlinie wird erstmals ein Rahmen für Anerkennungsleistungen von Seiten der EKD als kirchenrechtliche Norm gesetzt, um eine weitgehende Einheitlichkeit der Verfahren und Leistungen in allen Gliedkirchen zu erreichen. Das Anerkennungsverfahren wird als Verfahren eigener Art beschrieben, das nicht mit zivil- oder disziplinarrechtlichen oder anderen Verfahren zu vergleichen ist.
Abschluss der 16. Landessynode
Abschluss der 16. Landessynode
Die Herbsttagung war zugleich die Abschlusssitzung der 16. Landessynode. Am 30. November wählen die wahlberechtigten Kirchenmitglieder 7.000 Kirchengemeinderätinnen und Kirchengemeinderäte und die 90 Mitglieder der 17. Landessynode. Die konstituierende Sitzung wird am 28. Februar 2026 stattfinden. Synodalpräsidentin Sabine Foth blickte auf den Start der 16. Landessynode unter Corona-Bedingungen zurück. Im Rückblick kämen viele Fragen für die Zukunft auf, wie im Fall einer weiteren Pandemie oder ähnlichem zu reagieren sei. Die Beschlüsse zum digitalen Arbeiten seien ein kleiner Schritt für die Synode, aber ein großer Schritt im Allgemeinen gewesen. „Denn bis heute besteht die Möglichkeit der digitalen Teilnahme an den Synodaltagungen. Die Sorge, in Zukunft vor leeren oder zumindest fast leeren Stühlen zu tagen, hat sich zum Glück nicht bewahrheitet.“ Weitere Herausforderungen seien die real sinkenden Kirchensteuereinnahmen gewesen und die damit verbundenen Einsparvorschläge und -beschlüsse. Die Einsetzung des Sonderausschusses im Jahr 2020 halte Foth auch für mögliche inhaltlich übergreifende Fragestellungen in der Zukunft für wertvoll. Eine Empfehlung an die 17. Landessynode sei, mit der badischen Landessynode gemeinsame Tagungen der Ausschüsse und gegebenenfalls. der Landessynoden zu terminieren und „das Fernziel einer Fusion beider Landeskirchen achtsam in Gesprächen mit dem badischen Präsidium auszuloten und anzubahnen und dabei auch die Erfahrungen anderer Landeskirchen diesbezüglich in den Blick zu nehmen.“ Hier gelte es, zwischen den Synoden weiterzukommen, neben den bislang kleinen Schritten wie der gelungenen Fusion der Archive und Bibliotheken. Ihr persönlicher Wunsch sei neben der weiteren vertrauensvollen und offenen Zusammenarbeit zwischen Oberkirchenrat und Synode der weitere Blick über den württembergischen Tellerrand. „Von unseren Gemeinden fordern wir umzudenken, Neues auszuprobieren, Flexibilität und Offenheit. In der 16. Landessynode habe ich dies an vielen Stellen gespürt und ich hoffe, dass diese Haltung weiterwächst.“
Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl dankte in den Zeiten, in denen „die Verbundenheit vieler Menschen zur Kirche nachlässt“, den Synodalen für ihr Engagement: „Die Sitzungen der einzelnen Ausschüsse befassen sich mit komplexen Sachverhalten, die immer eine gründliche Einarbeitung und Vorbereitung erfordern.” Gohl erinnerte auch an seine Zeit als Synodaler und seine Wahl zum Landesbischof durch die Landessynode im Jahr 2022. Er danke für die konstruktive Begleitung und auch für geäußerte Kritik: „Denn nur, wenn die Irritation auch benannt wird, kann man sich dazu verhalten und nach Lösungen suchen. Deshalb bedauere ich sehr, dass wir bei der Frage der Trauung gleichgeschlechtlicher Ehepaare in dieser Legislatur keine Lösung gefunden haben. Ich bedauere, dass es nicht gelungen ist, Brücken zwischen unterschiedlichen Schriftverständnissen zu bauen, damit alle – gut reformatorisch – ihrem in der Heiligen Schrift begründeten Gewissen folgen können und sich gleichgeschlechtlich liebende Menschen nicht länger diskriminiert sehen.“ Bei anderen Fragen gelänge dies, beispielsweise bei der Frage, ob man als Christ Soldat bei Bundeswehr sein könne oder bei der Frage der Waffenlieferungen an die Ukraine. „Solche Brücken zwischen konträren Positionen sind in unseren Zeiten wichtiger denn je.“ Wie die Synodalpräsidentin in ihrer Abschlussrede hob auch Gohl die Startbedingungen der 16. Synode in der Corona-Pandemie hervor: „Als Glückfall erwies sich, dass wir in der Landeskirche mit der digitalen Infrastruktur schon so weit waren. So konnten wir sehr viel digital bewältigen.“ Dennoch sei die Synode nach den Lockdowns gefühlt ein zweites Mal gestartet. Gohl sprach weitere gewichtige Themen der 16. Landessynode an, wie den PfarrPlan 2030, das große Einsparpaket über knapp 104 Millionen Euro, das Klimaschutzgesetz, das Abendmahl in digitaler Form und die Befassung mit dem nie „abgearbeiteten“ Thema Sexualisierte Gewalt in Kirche und Diakonie. Die kontinuierliche Weiterarbeit in der Aufarbeitung und Prävention sei unstrittiger Konsens in der Landessynode. Erstmals seien in dieser Legislaturperiode zwei Vertreter der internationalen Gemeinden als beratende Mitglieder zu den Synodaltagungen zugelassen worden. Gohl ging weiter auf den Transformationsdruck ein: „Bei vielen kirchlich Hochengagierten – Ehren- wie Hauptamtlichen – nehme ich Erschöpfung wahr. Das sollten wir ernst nehmen und uns fragen, wie echte Entlastung aussehen kann. Ich sehe die Landessynode da in einer Vorbildrolle.“ Er wünsche sich eine Synode, in der Abstimmungen auch über die Grenzen der Gesprächskreise hinweg normal werden könnten, und eine Synode, „die auf ihren Tagungen keine Beschlüsse mehr nach 19:00 Uhr trifft. Ich wünsche mir eine Synode, in der Menschen mit Handicap über eine verbindliche Quote Sitz und Stimme haben. Ich wünsche mir eine Synode, die den Mut hat, kleiner zu werden, und die Zahl ihrer gewählten Mitglieder reduziert. Ich wünsche mir eine Synode, die die Zahl ihrer Anträge an den Oberkirchenrat verringert. Doch am Ende stehen nicht Wünsche, am Ende steht wie am Anfang der Dank!“ Namentlich dankte Gohl langgedienten Synodalen: Beate Keller für vier Legislaturperioden, also 24 Jahre, in der Landessynode. Und für drei Legislaturperioden – also 18 Lebensjahre – Ruth Bauer, Andrea Bleher, Matthias Böhler, Matthias Hanßmann, Anja Holland, Siegfried Jahn, Martin Plümicke und Steffen Kern (13. und 14. + 16.) – 15. pausiert.
Als ältestes Mitglied der 16. Landessynode hielt Hannelore Jessen zum Abschluss eine Ansprache. Diese war gespickt mit Formulierungen einer KI, wie Jessen schnell preisgab – und mit denen sie den Wandel zwischen Alt und Neu sowie Tradition und Aufbruch illustrierte. Wandel sei Teil des göttlichen Plans, aber „voraussagen mag ich auch nicht, wohin uns diese neue Errungenschaft führt. (…) Aber für den Wandel sollten wir auch Vernunft einsetzen, die Menschheit muss ständig mit Veränderungen umgehen, unsere Gemeinden kämpfen mit den neuen Verordnungen und Anweisungen und sind enttäuscht über den Verlust von Traditionen - nicht alles ist aus der Vernunft geboren.“ Fortschritt sei daher nicht unbedingt eine Erleichterung. In allen Gebieten würden Unwissenheit oder Unbekümmertheit von unlauteren oder geschäftstüchtigen Mitmenschen ausgenutzt. Besonders bedroht seien Kinder und Ältere. Auch die umfangreiche Speicherung der persönlichen Daten benannte Jessen. Sie sprach den Synodalen Mut zu, vor Ort in den Gemeinden kirchliches Leben zu gestalten und an der Ortsgemeinschaft mitzuwirken und bei Bedarf auch über die Gemeindegrenze hinauszuschauen und sich zu engagieren. „Die Landeskirche ist nichts ohne aktive Gemeinden und Menschen. Und hoffentlich gibt es für diese Welt bis dahin mehr Umweltbewusstsein, Menschenrechte und vor allen Dingen Frieden.“
Die Herbsttagung war zugleich die Abschlusssitzung der 16. der Landessynode. Am 30. November wählen die wahlberechtigten Kirchenmitglieder 7.000 Kirchengemeinderätinnen und Kirchengemeinderäte und die 90 Mitglieder der 17. Landessynode. Die konstituierende Sitzung wird am 28. Februar 2026 stattfinden.
Alle Themen der Tagung
⬆️ Zum Seitenanfang
✳️Landessynode kompakt: Die wichtigsten Themen im Überblick
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente:
- Grußworte
- Verabschiedung der Unabhängigen Kommission zur Gewährung von Leistungen in Anerkennung des Leids Betroffener sexualisierter Gewalt und Verleihung der Silbernen Brenz-Medaille an den Vorsitzenden Wolfgang Vögele
- TOP 01 Strategische Planung
- TOP 02 Planüberschreitungen und Jahresabschluss der landeskirchlichen Rechnung 2024
TOP 03 1. Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 mit Kirchlichem Gesetz - TOP 04 Trauung gleichgeschlechtlich liebender Ehepaare
- TOP 05
- TOP 06 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung und des Gottesdienstes anlässlich der Eheschließung (Beilage 145)
- TOP 07 Kirchliches Gesetz zur Ablösung des Diakonen- und Diakoninnengesetzes und zur Änderung des Württ. Pfarrergesetzes (Beilage 141)
- TOP 08 Kirchliches Gesetz zur Änderung von Dienstverpflichtungen (Beilage 140)
- TOP 09 Gottesdienstbuch für die Ev. Landeskirche in Württemberg, Zweiter Teil, Teilband Einführungen und Verabschiedungen
- TOP 10 Bericht über die Situation der verfolgten Christen in der Welt sowie der Menschen, die aus religiösen, rassistischen, politischen, ethnischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gründen unter Verfolgung leiden – Schwerpunkt auf Syrien, Kolumbien, Nigeria und Pakistan
- TOP 11 Berichte des Beauftragten für die Entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs und des Islambeauftragten
- TOP 12 Aktuelle Stunde
- TOP 13 Schlussbericht des Ausschusses für Mission, Ökumene und Entwicklung
- TOP 14 Schlussbericht des Finanzausschusses
- TOP 15 Schlussbericht des Ausschusses für Bildung und Jugend
- TOP 16 Änderung des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes
- TOP 17 Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 18 Bericht der Projektstelle für die Themen Rassismus und Antisemitismus/Populismus und Extremismus
- Bildergalerie: Impressionen der Herbsttagung
- TOP 19 Abschaffung der Aktuellen Stunde
- TOP 20 OIKOS und die AKSB
- TOP 21 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (Beilage 142)
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (144)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Kirchengemeindeordnung und weiterer Regelungen (Beilage 143)
- TOP 24 Schlussbericht des Rechtsausschusses
- TOP 25 Selbständige Anträge
- TOP 26 Förmliche Anfragen
- TOP 27 Schlussbericht des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung
- TOP 28 Schlussbericht des Theologischen Ausschusses
- TOP 29 Abschlussbericht des Projekts „Geistlich Leiten, vom Geist geleitet“
- TOP 30 Schlussbericht des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung
- TOP 31 „Raum geben“ - Zwischenbericht zu den Projekten „Aufbruch Quartier“ und „Aufbruch Wohnen“
- TOP 32 Abschlussbericht des Projekts „Zukunftsgutscheine”
- TOP 33 Zwischenbericht zum Fonds „#miteinander“
- TOP 34 Schlussbericht des Ausschusses für Diakonie
- TOP 35 Schlussbericht des Sonderausschusses für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte
- TOP 36 Abschluss der 16. Landessynode
- Gottesdienst mit Abendmahl in der Stiftskirche
Grußworte
Alle Themen der Tagung
⬆️ Zum Seitenanfang
✳️Landessynode kompakt: Die wichtigsten Themen im Überblick
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente:
- Grußworte
- Verabschiedung der Unabhängigen Kommission zur Gewährung von Leistungen in Anerkennung des Leids Betroffener sexualisierter Gewalt und Verleihung der Silbernen Brenz-Medaille an den Vorsitzenden Wolfgang Vögele
- TOP 01 Strategische Planung
- TOP 02 Planüberschreitungen und Jahresabschluss der landeskirchlichen Rechnung 2024
TOP 03 1. Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 mit Kirchlichem Gesetz - TOP 04 Trauung gleichgeschlechtlich liebender Ehepaare
- TOP 05
- TOP 06 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung und des Gottesdienstes anlässlich der Eheschließung (Beilage 145)
- TOP 07 Kirchliches Gesetz zur Ablösung des Diakonen- und Diakoninnengesetzes und zur Änderung des Württ. Pfarrergesetzes (Beilage 141)
- TOP 08 Kirchliches Gesetz zur Änderung von Dienstverpflichtungen (Beilage 140)
- TOP 09 Gottesdienstbuch für die Ev. Landeskirche in Württemberg, Zweiter Teil, Teilband Einführungen und Verabschiedungen
- TOP 10 Bericht über die Situation der verfolgten Christen in der Welt sowie der Menschen, die aus religiösen, rassistischen, politischen, ethnischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gründen unter Verfolgung leiden – Schwerpunkt auf Syrien, Kolumbien, Nigeria und Pakistan
- TOP 11 Berichte des Beauftragten für die Entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs und des Islambeauftragten
- TOP 12 Aktuelle Stunde
- TOP 13 Schlussbericht des Ausschusses für Mission, Ökumene und Entwicklung
- TOP 14 Schlussbericht des Finanzausschusses
- TOP 15 Schlussbericht des Ausschusses für Bildung und Jugend
- TOP 16 Änderung des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes
- TOP 17 Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 18 Bericht der Projektstelle für die Themen Rassismus und Antisemitismus/Populismus und Extremismus
- Bildergalerie:Impressionen der Herbsttagung
- TOP 19 Abschaffung der Aktuellen Stunde
- TOP 20 OIKOS und die AKSB
- TOP 21 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (Beilage 142)
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (144)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Kirchengemeindeordnung und weiterer Regelungen (Beilage 143)
- TOP 24 Schlussbericht des Rechtsausschusses
- TOP 25 Selbständige Anträge
- TOP 26 Förmliche Anfragen
- TOP 27 Schlussbericht des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung
- TOP 28 Schlussbericht des Theologischen Ausschusses
- TOP 29 Abschlussbericht des Projekts „Geistlich Leiten, vom Geist geleitet“
- TOP 30 Schlussbericht des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung
- TOP 31 „Raum geben“ - Zwischenbericht zu den Projekten „Aufbruch Quartier“ und „Aufbruch Wohnen“
- TOP 32 Abschlussbericht des Projekts „Zukunftsgutscheine”
- TOP 33 Zwischenbericht zum Fonds „#miteinander“
- TOP 34 Schlussbericht des Ausschusses für Diakonie
- TOP 35 Schlussbericht des Sonderausschusses für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte
- TOP 36 Abschluss der 16. Landessynode
- Gottesdienst mit Abendmahl in der Stiftskirche
Dokumente zu den Grußworten
Die Dokumente zum Tagesordnungspunkt werden mit Aufruf des Tagesordnungspunktes hier zum Download veröffentlicht.
Alle Themen der Tagung
⬆️ Zum Seitenanfang
✳️Landessynode kompakt: Die wichtigsten Themen im Überblick
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente:
- Grußworte
- Verabschiedung der Unabhängigen Kommission zur Gewährung von Leistungen in Anerkennung des Leids Betroffener sexualisierter Gewalt und Verleihung der Silbernen Brenz-Medaille an den Vorsitzenden Wolfgang Vögele
- TOP 01 Strategische Planung
- TOP 02 Planüberschreitungen und Jahresabschluss der landeskirchlichen Rechnung 2024
TOP 03 1. Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 mit Kirchlichem Gesetz - TOP 04 Trauung gleichgeschlechtlich liebender Ehepaare
- TOP 05
- TOP 06 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung und des Gottesdienstes anlässlich der Eheschließung (Beilage 145)
- TOP 07 Kirchliches Gesetz zur Ablösung des Diakonen- und Diakoninnengesetzes und zur Änderung des Württ. Pfarrergesetzes (Beilage 141)
- TOP 08 Kirchliches Gesetz zur Änderung von Dienstverpflichtungen (Beilage 140)
- TOP 09 Gottesdienstbuch für die Ev. Landeskirche in Württemberg, Zweiter Teil, Teilband Einführungen und Verabschiedungen
- TOP 10 Bericht über die Situation der verfolgten Christen in der Welt sowie der Menschen, die aus religiösen, rassistischen, politischen, ethnischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gründen unter Verfolgung leiden – Schwerpunkt auf Syrien, Kolumbien, Nigeria und Pakistan
- TOP 11 Berichte des Beauftragten für die Entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs und des Islambeauftragten
- TOP 12 Aktuelle Stunde
- TOP 13 Schlussbericht des Ausschusses für Mission, Ökumene und Entwicklung
- TOP 14 Schlussbericht des Finanzausschusses
- TOP 15 Schlussbericht des Ausschusses für Bildung und Jugend
- TOP 16 Änderung des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes
- TOP 17 Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 18 Bericht der Projektstelle für die Themen Rassismus und Antisemitismus/Populismus und Extremismus
- Bildergalerie:Impressionen der Herbsttagung
- TOP 19 Abschaffung der Aktuellen Stunde
- TOP 20 OIKOS und die AKSB
- TOP 21 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (Beilage 142)
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (144)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Kirchengemeindeordnung und weiterer Regelungen (Beilage 143)
- TOP 24 Schlussbericht des Rechtsausschusses
- TOP 25 Selbständige Anträge
- TOP 26 Förmliche Anfragen
- TOP 27 Schlussbericht des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung
- TOP 28 Schlussbericht des Theologischen Ausschusses
- TOP 29 Abschlussbericht des Projekts „Geistlich Leiten, vom Geist geleitet“
- TOP 30 Schlussbericht des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung
- TOP 31 „Raum geben“ - Zwischenbericht zu den Projekten „Aufbruch Quartier“ und „Aufbruch Wohnen“
- TOP 32 Abschlussbericht des Projekts „Zukunftsgutscheine”
- TOP 33 Zwischenbericht zum Fonds „#miteinander“
- TOP 34 Schlussbericht des Ausschusses für Diakonie
- TOP 35 Schlussbericht des Sonderausschusses für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte
- TOP 36 Abschluss der 16. Landessynode
- Gottesdienst mit Abendmahl in der Stiftskirche
Dokumente zu den Grußworten
Die Dokumente zum Tagesordnungspunkt werden mit Aufruf des Tagesordnungspunktes hier zum Download veröffentlicht.
Grußwort von Bischof Leon Novak, Evangelische Kirche Augsburgischen Bekenntnisses (AB) in der Republik Slowenien

Bischof Mag. Leon Novak von der evangelischen Kirche AB in Slowenien dankte der württembergischen Landeskirche für die enge Verbundenheit. Diese Partnerschaft habe sich zuletzt in der Unterstützung für ein Treffen von Jugendlichen aus Kroatien, Serbien und Slowenien zum Thema Vergebung, Versöhnung und Friedensarbeit, August 2025 in Koper gezeigt. Zudem berichtete Novak, dass sich 2025 zwei bisherige Pfingstgemeinden der evangelischen Kirche AB in Slowenien angeschlossen hätten. Novak sagte, dies sei „für uns ein Zeichen der Hoffnung und der geistlichen Dynamik“.
Das vollständige Grußwort von Bischof Leon Novak finden Sie in der Klappbox oben: Dokumente zu den Grußworten
Alle Themen der Tagung
⬆️ Zum Seitenanfang
✳️Landessynode kompakt: Die wichtigsten Themen im Überblick
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente:
- Grußworte
- Verabschiedung der Unabhängigen Kommission zur Gewährung von Leistungen in Anerkennung des Leids Betroffener sexualisierter Gewalt und Verleihung der Silbernen Brenz-Medaille an den Vorsitzenden Wolfgang Vögele
- TOP 01 Strategische Planung
- TOP 02 Planüberschreitungen und Jahresabschluss der landeskirchlichen Rechnung 2024
TOP 03 1. Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 mit Kirchlichem Gesetz - TOP 04 Trauung gleichgeschlechtlich liebender Ehepaare
- TOP 05
- TOP 06 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung und des Gottesdienstes anlässlich der Eheschließung (Beilage 145)
- TOP 07 Kirchliches Gesetz zur Ablösung des Diakonen- und Diakoninnengesetzes und zur Änderung des Württ. Pfarrergesetzes (Beilage 141)
- TOP 08 Kirchliches Gesetz zur Änderung von Dienstverpflichtungen (Beilage 140)
- TOP 09 Gottesdienstbuch für die Ev. Landeskirche in Württemberg, Zweiter Teil, Teilband Einführungen und Verabschiedungen
- TOP 10 Bericht über die Situation der verfolgten Christen in der Welt sowie der Menschen, die aus religiösen, rassistischen, politischen, ethnischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gründen unter Verfolgung leiden – Schwerpunkt auf Syrien, Kolumbien, Nigeria und Pakistan
- TOP 11 Berichte des Beauftragten für die Entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs und des Islambeauftragten
- TOP 12 Aktuelle Stunde
- TOP 13 Schlussbericht des Ausschusses für Mission, Ökumene und Entwicklung
- TOP 14 Schlussbericht des Finanzausschusses
- TOP 15 Schlussbericht des Ausschusses für Bildung und Jugend
- TOP 16 Änderung des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes
- TOP 17 Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 18 Bericht der Projektstelle für die Themen Rassismus und Antisemitismus/Populismus und Extremismus
- Bildergalerie:Impressionen der Herbsttagung
- TOP 19 Abschaffung der Aktuellen Stunde
- TOP 20 OIKOS und die AKSB
- TOP 21 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (Beilage 142)
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (144)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Kirchengemeindeordnung und weiterer Regelungen (Beilage 143)
- TOP 24 Schlussbericht des Rechtsausschusses
- TOP 25 Selbständige Anträge
- TOP 26 Förmliche Anfragen
- TOP 27 Schlussbericht des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung
- TOP 28 Schlussbericht des Theologischen Ausschusses
- TOP 29 Abschlussbericht des Projekts „Geistlich Leiten, vom Geist geleitet“
- TOP 30 Schlussbericht des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung
- TOP 31 „Raum geben“ - Zwischenbericht zu den Projekten „Aufbruch Quartier“ und „Aufbruch Wohnen“
- TOP 32 Abschlussbericht des Projekts „Zukunftsgutscheine”
- TOP 33 Zwischenbericht zum Fonds „#miteinander“
- TOP 34 Schlussbericht des Ausschusses für Diakonie
- TOP 35 Schlussbericht des Sonderausschusses für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte
- TOP 36 Abschluss der 16. Landessynode
- Gottesdienst mit Abendmahl in der Stiftskirche
Dokumente zu den Grußworten
Die Dokumente zum Tagesordnungspunkt werden mit Aufruf des Tagesordnungspunktes hier zum Download veröffentlicht.
Grußwort von Hermann Lorenz, Synodalpräsident der Evangelischen Kirche der Pfalz

Synodalpräsident Hermann Lorenz berichtete in seinem Grußwort von den tiefgreifenden Veränderungen, an denen seine Kirche arbeite, da es mit der „früheren Ordnung nicht weitergehen“ könne. Man habe sich auf den Weg gemacht, „die Struktur unserer Kirche zu verändern und den gegebenen Verhältnissen wie Mitgliederzahlen und Finanzausstattung anzupassen.“ Im November wolle die Synode entscheiden, wie es mit den verschiedenen Reformelementen weitergehe.
So sollen zum Beispiel 15 Kirchenbezirke zu vier zusammengeschlossen werden. Die kirchlichen Kindertagesstätten sollen einen gemeinsamen Träger bekommen. Die Kirchengemeinden sollen ihren Status als Körperschaften öffentlichen Rechts verlieren und zu Körperschaften kirchlichen Rechts werden, das Eigentum an Immobilien an die Landeskirche abgeben und auch keinen eigenen Haushalt mehr aufstellen, sondern Budgets aus dem landeskirchlichen Haushalt erhalten und verwalten.
Lorenz betonte, das Presbyterium (vergleichbar dem Kirchengemeinderat in Württemberg) werde weiter „die Gemeinde leiten und Verantwortung für die Verkündigung des Evangeliums in Wort und Sakrament, die Seelsorge, die christliche Bildung, die Diakonie und Mission sowie für die Einhaltung der kirchlichen Ordnung tragen.“ Auch müsse die Kirchengemeinde „weiterhin für die pflegliche und dem Nutzungsverhältnis entsprechende Behandlung von Gebäuden und Zubehör zu sorgen.“
Das vollständige Grußwort von Hermann Lorenz finden Sie in der Klappbox oben: Dokumente zu den Grußworten
Alle Themen der Tagung
⬆️ Zum Seitenanfang
✳️Landessynode kompakt: Die wichtigsten Themen im Überblick
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente:
- Grußworte
- Verabschiedung der Unabhängigen Kommission zur Gewährung von Leistungen in Anerkennung des Leids Betroffener sexualisierter Gewalt und Verleihung der Silbernen Brenz-Medaille an den Vorsitzenden Wolfgang Vögele
- TOP 01 Strategische Planung
- TOP 02 Planüberschreitungen und Jahresabschluss der landeskirchlichen Rechnung 2024
TOP 03 1. Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 mit Kirchlichem Gesetz - TOP 04 Trauung gleichgeschlechtlich liebender Ehepaare
- TOP 05
- TOP 06 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung und des Gottesdienstes anlässlich der Eheschließung (Beilage 145)
- TOP 07 Kirchliches Gesetz zur Ablösung des Diakonen- und Diakoninnengesetzes und zur Änderung des Württ. Pfarrergesetzes (Beilage 141)
- TOP 08 Kirchliches Gesetz zur Änderung von Dienstverpflichtungen (Beilage 140)
- TOP 09 Gottesdienstbuch für die Ev. Landeskirche in Württemberg, Zweiter Teil, Teilband Einführungen und Verabschiedungen
- TOP 10 Bericht über die Situation der verfolgten Christen in der Welt sowie der Menschen, die aus religiösen, rassistischen, politischen, ethnischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gründen unter Verfolgung leiden – Schwerpunkt auf Syrien, Kolumbien, Nigeria und Pakistan
- TOP 11 Berichte des Beauftragten für die Entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs und des Islambeauftragten
- TOP 12 Aktuelle Stunde
- TOP 13 Schlussbericht des Ausschusses für Mission, Ökumene und Entwicklung
- TOP 14 Schlussbericht des Finanzausschusses
- TOP 15 Schlussbericht des Ausschusses für Bildung und Jugend
- TOP 16 Änderung des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes
- TOP 17 Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 18 Bericht der Projektstelle für die Themen Rassismus und Antisemitismus/Populismus und Extremismus
- Bildergalerie:Impressionen der Herbsttagung
- TOP 19 Abschaffung der Aktuellen Stunde
- TOP 20 OIKOS und die AKSB
- TOP 21 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (Beilage 142)
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (144)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Kirchengemeindeordnung und weiterer Regelungen (Beilage 143)
- TOP 24 Schlussbericht des Rechtsausschusses
- TOP 25 Selbständige Anträge
- TOP 26 Förmliche Anfragen
- TOP 27 Schlussbericht des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung
- TOP 28 Schlussbericht des Theologischen Ausschusses
- TOP 29 Abschlussbericht des Projekts „Geistlich Leiten, vom Geist geleitet“
- TOP 30 Schlussbericht des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung
- TOP 31 „Raum geben“ - Zwischenbericht zu den Projekten „Aufbruch Quartier“ und „Aufbruch Wohnen“
- TOP 32 Abschlussbericht des Projekts „Zukunftsgutscheine”
- TOP 33 Zwischenbericht zum Fonds „#miteinander“
- TOP 34 Schlussbericht des Ausschusses für Diakonie
- TOP 35 Schlussbericht des Sonderausschusses für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte
- TOP 36 Abschluss der 16. Landessynode
- Gottesdienst mit Abendmahl in der Stiftskirche
Dokumente zu den Grußworten
Die Dokumente zum Tagesordnungspunkt werden mit Aufruf des Tagesordnungspunktes hier zum Download veröffentlicht.
Grußwort von Bischof Rolf Bareis, Evangelisch-lutherische Kirche in Georgien und im Südlichen Kaukasus

Bischof Rolf Bareis von der Evangelisch-lutherischen Kirche Georgiens und des südlichen Kaukasus berichtete ausführlich von der konfliktreichen politischen Lage in der Region und von den Auswirkungen auf die Kirche. Bareis betonte aber auch, wie positiv seine kleine Kirche dank ihres großen diakonischen Engagements in die Gesellschaft wirke und wahrgenommen werde. Auch sei die Vernetzung mit anderen Konfessionen und Religionsgemeinschaften gut. Bareis dankte der württembergischen Landeskirche für die enge Partnerschaft und die gute Unterstützung. Diese sei in Anbetracht der schwierigen politischen Situation sehr wertvoll.
Das vollständige Grußwort von Bischof Rolf Bareis finden Sie in der Klappbox oben: Dokumente zu den Grußworten
Alle Themen der Tagung
⬆️ Zum Seitenanfang
✳️Landessynode kompakt: Die wichtigsten Themen im Überblick
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente:
- Grußworte
- Verabschiedung der Unabhängigen Kommission zur Gewährung von Leistungen in Anerkennung des Leids Betroffener sexualisierter Gewalt und Verleihung der Silbernen Brenz-Medaille an den Vorsitzenden Wolfgang Vögele
- TOP 01 Strategische Planung
- TOP 02 Planüberschreitungen und Jahresabschluss der landeskirchlichen Rechnung 2024
TOP 03 1. Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 mit Kirchlichem Gesetz - TOP 04 Trauung gleichgeschlechtlich liebender Ehepaare
- TOP 05
- TOP 06 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung und des Gottesdienstes anlässlich der Eheschließung (Beilage 145)
- TOP 07 Kirchliches Gesetz zur Ablösung des Diakonen- und Diakoninnengesetzes und zur Änderung des Württ. Pfarrergesetzes (Beilage 141)
- TOP 08 Kirchliches Gesetz zur Änderung von Dienstverpflichtungen (Beilage 140)
- TOP 09 Gottesdienstbuch für die Ev. Landeskirche in Württemberg, Zweiter Teil, Teilband Einführungen und Verabschiedungen
- TOP 10 Bericht über die Situation der verfolgten Christen in der Welt sowie der Menschen, die aus religiösen, rassistischen, politischen, ethnischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gründen unter Verfolgung leiden – Schwerpunkt auf Syrien, Kolumbien, Nigeria und Pakistan
- TOP 11 Berichte des Beauftragten für die Entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs und des Islambeauftragten
- TOP 12 Aktuelle Stunde
- TOP 13 Schlussbericht des Ausschusses für Mission, Ökumene und Entwicklung
- TOP 14 Schlussbericht des Finanzausschusses
- TOP 15 Schlussbericht des Ausschusses für Bildung und Jugend
- TOP 16 Änderung des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes
- TOP 17 Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 18 Bericht der Projektstelle für die Themen Rassismus und Antisemitismus/Populismus und Extremismus
- Bildergalerie:Impressionen der Herbsttagung
- TOP 19 Abschaffung der Aktuellen Stunde
- TOP 20 OIKOS und die AKSB
- TOP 21 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (Beilage 142)
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (144)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Kirchengemeindeordnung und weiterer Regelungen (Beilage 143)
- TOP 24 Schlussbericht des Rechtsausschusses
- TOP 25 Selbständige Anträge
- TOP 26 Förmliche Anfragen
- TOP 27 Schlussbericht des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung
- TOP 28 Schlussbericht des Theologischen Ausschusses
- TOP 29 Abschlussbericht des Projekts „Geistlich Leiten, vom Geist geleitet“
- TOP 30 Schlussbericht des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung
- TOP 31 „Raum geben“ - Zwischenbericht zu den Projekten „Aufbruch Quartier“ und „Aufbruch Wohnen“
- TOP 32 Abschlussbericht des Projekts „Zukunftsgutscheine”
- TOP 33 Zwischenbericht zum Fonds „#miteinander“
- TOP 34 Schlussbericht des Ausschusses für Diakonie
- TOP 35 Schlussbericht des Sonderausschusses für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte
- TOP 36 Abschluss der 16. Landessynode
- Gottesdienst mit Abendmahl in der Stiftskirche
Dokumente zu den Grußworten
Die Dokumente zum Tagesordnungspunkt werden mit Aufruf des Tagesordnungspunktes hier zum Download veröffentlicht.
Grußwort von Oberkirchenrat Dr. Steffen Merle, Referent für Sozial- und Gesellschaftspolitik, Evangelische Kirche in Deutschland

Oberkirchenrat Dr. Steffen Merle von der Evangelischen Kirche in Deutschland sprach in seinem Grußwort von der christlichen Hoffnung und wie Kirche diese Hoffnung auch in die aktuellen gesellschaftlichen Debatten einbringen könne: Krieg und Frieden, Klimawandel, Soziale Gerechtigkeit, Sexualisierte Gewalt. Merle sagte, es müsse gelingen: „die vielen Themen öffentlicher Verantwortung mit dem zu verbinden, was ich mal theologisches ‘Existential’ nennen möchte – damit es Menschen berührt, sie in ihrem Leben und Glauben berührt. Sonst gehen die Debatten um Frieden, Klima oder soziales Miteinander an Menschen vorbei, über ihre Köpfe hinweg.“ Merle appellierte: „Lasst uns in allem fröhlich Hoffnungs-Kirche sein“.
Das vollständige Grußwort von Oberkirchenrat Dr. Steffen Merle finden Sie in der Klappbox oben: Dokumente zu den Grußworten
Alle Themen der Tagung
⬆️ Zum Seitenanfang
✳️Landessynode kompakt: Die wichtigsten Themen im Überblick
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente:
- Grußworte
- Verabschiedung der Unabhängigen Kommission zur Gewährung von Leistungen in Anerkennung des Leids Betroffener sexualisierter Gewalt und Verleihung der Silbernen Brenz-Medaille an den Vorsitzenden Wolfgang Vögele
- TOP 01 Strategische Planung
- TOP 02 Planüberschreitungen und Jahresabschluss der landeskirchlichen Rechnung 2024
TOP 03 1. Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 mit Kirchlichem Gesetz - TOP 04 Trauung gleichgeschlechtlich liebender Ehepaare
- TOP 05
- TOP 06 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung und des Gottesdienstes anlässlich der Eheschließung (Beilage 145)
- TOP 07 Kirchliches Gesetz zur Ablösung des Diakonen- und Diakoninnengesetzes und zur Änderung des Württ. Pfarrergesetzes (Beilage 141)
- TOP 08 Kirchliches Gesetz zur Änderung von Dienstverpflichtungen (Beilage 140)
- TOP 09 Gottesdienstbuch für die Ev. Landeskirche in Württemberg, Zweiter Teil, Teilband Einführungen und Verabschiedungen
- TOP 10 Bericht über die Situation der verfolgten Christen in der Welt sowie der Menschen, die aus religiösen, rassistischen, politischen, ethnischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gründen unter Verfolgung leiden – Schwerpunkt auf Syrien, Kolumbien, Nigeria und Pakistan
- TOP 11 Berichte des Beauftragten für die Entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs und des Islambeauftragten
- TOP 12 Aktuelle Stunde
- TOP 13 Schlussbericht des Ausschusses für Mission, Ökumene und Entwicklung
- TOP 14 Schlussbericht des Finanzausschusses
- TOP 15 Schlussbericht des Ausschusses für Bildung und Jugend
- TOP 16 Änderung des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes
- TOP 17 Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 18 Bericht der Projektstelle für die Themen Rassismus und Antisemitismus/Populismus und Extremismus
- Bildergalerie:Impressionen der Herbsttagung
- TOP 19 Abschaffung der Aktuellen Stunde
- TOP 20 OIKOS und die AKSB
- TOP 21 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (Beilage 142)
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (144)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Kirchengemeindeordnung und weiterer Regelungen (Beilage 143)
- TOP 24 Schlussbericht des Rechtsausschusses
- TOP 25 Selbständige Anträge
- TOP 26 Förmliche Anfragen
- TOP 27 Schlussbericht des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung
- TOP 28 Schlussbericht des Theologischen Ausschusses
- TOP 29 Abschlussbericht des Projekts „Geistlich Leiten, vom Geist geleitet“
- TOP 30 Schlussbericht des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung
- TOP 31 „Raum geben“ - Zwischenbericht zu den Projekten „Aufbruch Quartier“ und „Aufbruch Wohnen“
- TOP 32 Abschlussbericht des Projekts „Zukunftsgutscheine”
- TOP 33 Zwischenbericht zum Fonds „#miteinander“
- TOP 34 Schlussbericht des Ausschusses für Diakonie
- TOP 35 Schlussbericht des Sonderausschusses für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte
- TOP 36 Abschluss der 16. Landessynode
- Gottesdienst mit Abendmahl in der Stiftskirche
Dokumente zu den Grußworten
Die Dokumente zum Tagesordnungspunkt werden mit Aufruf des Tagesordnungspunktes hier zum Download veröffentlicht.
Grußwort von Karl Kreß, Vizepräsident der Landessynode der Evangelischen Landeskirche in Baden

Synodalpräsident Karl Kreß berichtete in seinem Grußwort von den harten Sparmaßnahmen, die die badische Landessynode beschließen musste, sowie von den neuen Organisationsformen, die man entwickeln müsse. Er erinnerte aber auch daran, dass Zahlen und Organisation nicht das Wesentliche seien: „Wir sehen immer nur die Zahlen, aber das lebendige Wort, den Herrn Jesus Christus sehen wir vor all dem Wald aus Zahlen nicht mehr Nochmals, ich rede hier als Pfarrer, aber auch als Controller. Gerade als solcher sage ich, wer den Inhalt vor lauter Zahlen nicht mehr sieht, geht insolvent. Kirche ist anders als unser Denken. Jesus Christus lebt, deshalb werden wir, als Glieder an seinem Leib, als Kirche des Heilands in der Welt niemals untergehen. Wie das organisiert ist, ist den jeweiligen gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten geschuldet.“
Kreß berichtete auch von Sani Ibrahim Azar (Bischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Jordanien und im Heiligen Land), der bei der Herbsttagung der badischen Landessynode mit Blick auf die schwierige Lage der Christen im Nahen Osten die These vertreten habe, die Weltchristenheit werde zerbrechen, wenn es keine Christen mehr im Heiligen Land gebe. Kreß fragte: „Wenn es keine Christen mehr im Heiligen Land gibt, gibt es dort keine Versöhnung. Und wenn es keine Versöhnung im Heiligen Land gibt, wie dann in der Welt? Damit bin ich wirklich theologisch nur am Anfang meines Denkens, bestimmt noch nicht fertig. Aber aufgewühlt.“
Das vollständige Grußwort von Karl Kreß finden Sie in der Klappbox oben: Dokumente zu den Grußworten
Verabschiedung der Unabhängigen Kommission zur Gewährung von Leistungen in Anerkennung des Leids Betroffener sexualisierter Gewalt und Verleihung der Silbernen Brenz-Medaille an den Vorsitzenden Wolfgang Vögele
Alle Themen der Tagung
⬆️ Zum Seitenanfang
✳️Landessynode kompakt: Die wichtigsten Themen im Überblick
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente:
- Grußworte
- Verabschiedung der Unabhängigen Kommission zur Gewährung von Leistungen in Anerkennung des Leids Betroffener sexualisierter Gewalt und Verleihung der Silbernen Brenz-Medaille an den Vorsitzenden Wolfgang Vögele
- TOP 01 Strategische Planung
- TOP 02 Planüberschreitungen und Jahresabschluss der landeskirchlichen Rechnung 2024
TOP 03 1. Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 mit Kirchlichem Gesetz - TOP 04 Trauung gleichgeschlechtlich liebender Ehepaare
- TOP 05
- TOP 06 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung und des Gottesdienstes anlässlich der Eheschließung (Beilage 145)
- TOP 07 Kirchliches Gesetz zur Ablösung des Diakonen- und Diakoninnengesetzes und zur Änderung des Württ. Pfarrergesetzes (Beilage 141)
- TOP 08 Kirchliches Gesetz zur Änderung von Dienstverpflichtungen (Beilage 140)
- TOP 09 Gottesdienstbuch für die Ev. Landeskirche in Württemberg, Zweiter Teil, Teilband Einführungen und Verabschiedungen
- TOP 10 Bericht über die Situation der verfolgten Christen in der Welt sowie der Menschen, die aus religiösen, rassistischen, politischen, ethnischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gründen unter Verfolgung leiden – Schwerpunkt auf Syrien, Kolumbien, Nigeria und Pakistan
- TOP 11 Berichte des Beauftragten für die Entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs und des Islambeauftragten
- TOP 12 Aktuelle Stunde
- TOP 13 Schlussbericht des Ausschusses für Mission, Ökumene und Entwicklung
- TOP 14 Schlussbericht des Finanzausschusses
- TOP 15 Schlussbericht des Ausschusses für Bildung und Jugend
- TOP 16 Änderung des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes
- TOP 17 Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 18 Bericht der Projektstelle für die Themen Rassismus und Antisemitismus/Populismus und Extremismus
- Bildergalerie:Impressionen der Herbsttagung
- TOP 19 Abschaffung der Aktuellen Stunde
- TOP 20 OIKOS und die AKSB
- TOP 21 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (Beilage 142)
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (144)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Kirchengemeindeordnung und weiterer Regelungen (Beilage 143)
- TOP 24 Schlussbericht des Rechtsausschusses
- TOP 25 Selbständige Anträge
- TOP 26 Förmliche Anfragen
- TOP 27 Schlussbericht des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung
- TOP 28 Schlussbericht des Theologischen Ausschusses
- TOP 29 Abschlussbericht des Projekts „Geistlich Leiten, vom Geist geleitet“
- TOP 30 Schlussbericht des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung
- TOP 31 „Raum geben“ - Zwischenbericht zu den Projekten „Aufbruch Quartier“ und „Aufbruch Wohnen“
- TOP 32 Abschlussbericht des Projekts „Zukunftsgutscheine”
- TOP 33 Zwischenbericht zum Fonds „#miteinander“
- TOP 34 Schlussbericht des Ausschusses für Diakonie
- TOP 35 Schlussbericht des Sonderausschusses für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte
- TOP 36 Abschluss der 16. Landessynode
- Gottesdienst mit Abendmahl in der Stiftskirche
Dokumente
Zu diesem Tagesordnungspunkt liegen keine Dokumente vor.
Anerkennungsleistungen werden durch EKD-weite Richtlinie abgelöst
Die Mitglieder der Unabhängigen Kommission zur Anerkennung erlittenen Leides in Landeskirche und Diakonie sind im Rahmen des ersten Sitzungstages der Landessynode aus ihrer Tätigkeit verabschiedet worden. Das System der bisher pauschal zuerkannten Anerkennungsleistungen wird ab Januar 2026 von einer neuen, EKD-weiten Richtlinie abgelöst.

Die Mitglieder der Unabhängigen Kommission zur Anerkennung erlittenen Leides in Landeskirche und Diakonie sind im Rahmen des ersten Sitzungstages der Herbsttagung der 16. Landessynode aus ihrer Tätigkeit verabschiedet worden. Die bisherige Kommission beendet damit nun nach über 10 Jahren ihre Arbeit. Synodalpräsidentin Sabine Foth dankte den Mitgliedern der Unabhängigen Kommission im Namen der Landessynode für ihr wichtiges Engagement. Das System der bisher pauschal zuerkannten Anerkennungsleistungen in der Landeskirche Württemberg wird ab Januar 2026 von einer neuen, EKD-weiten Richtlinie abgelöst, die neben dem Sockelbetrag in Höhe von 15.000 Euro bei strafrechtlich relevanten Taten dann auch individuelle Leistungen gewährt.
Die Unabhängige Kommission nahm 2014 ihre Arbeit auf. Von Anfang an gehörte ihr Wolfgang Vögele, Jurist und ehemaliger Richter einer großen Jugendstrafkammer am Landgericht Stuttgart, als Vorsitzender an. Weitere Mitglieder waren Marie-Louise Stöger, die Geschäftsführerin und Leiterin der Fachberatungsstelle Wildwasser Stuttgart e.V. sowie Hans Fischer, Diakon und ehemaliger Leiter von Jugendhilfeeinrichtungen der Diakonie. Nach dem Tod von Stöger im Jahr 2020 folgten Martina Huck von Wildwasser und an ihrer Stelle 2023 Katja Leonhardt, die ebenfalls Traumatherapeutin ist. Die Unabhängige Kommission hat bisher (Stand September 2025) 221 Anträge bearbeitet: In 200 Fällen hat sie Betroffenen von sexualisierter Gewalt sogenannte Anerkennungsleistungen, ergänzende Hilfeleistungen und Therapiekosten in Höhe von über 4,5 Millionen Euro zugesprochen. Wenige Anträge sind abgelehnt worden und 16 Anträge sind zuständigkeitshalber weiter verwiesen worden.
Die neue EKD-weite Regelung wird die neue Kommission umsetzen. Sie besteht aus Thomas Dörr, Präsident des Landgerichts a.D., Ravensburg und Ulm, Prof. Dr. Birgit Meyer, Politikwissenschaftlerin, Hochschule in Esslingen, sowie Stephen Church, Dipl.-Psych., Traumatherapeut und ehemaliger Fachberater in der Jugendhilfe. Die Mitglieder werden im Rahmen der Sommertagung der 17. Landessynode vorgestellt werden.
Alle neuen Kommissionen sind unabhängig besetzt, wie es in der Landeskirche und ihrer Diakonie in Württemberg von Anfang an war. Die Mitglieder werden durch die Leitungen der jeweiligen Verbünde berufen, arbeiten ehrenamtlich und sind externe Expertinnen und Experten aus verschiedenen Bereichen. Mindestens ein Mitglied muss die Befähigung zum Richteramt haben. Die Mitglieder dürfen nicht bei Kirche oder Diakonie beschäftigt sein. Mit der neuen Richtlinie wird erstmals ein Rahmen für Anerkennungsleistungen von Seiten der EKD als kirchenrechtliche Norm gesetzt, um eine weitgehende Einheitlichkeit der Verfahren und Leistungen in allen Gliedkirchen zu erreichen. Das Anerkennungsverfahren wird als Verfahren eigener Art beschrieben, das nicht mit zivil- oder disziplinarrechtlichen oder anderen Verfahren zu vergleichen ist.
Verleihung der Brenz-Medaille

Wolfgang Vögele ist mit der Silbernen Brenz-Medaille, der höchsten Auszeichnung der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, während der Herbsttagung der Landessynode geehrt worden.
Die Unabhängige Kommission zur Anerkennung erlittenen Leids in Landeskirche und Diakonie wurde 2014 ins Leben gerufen. Wolfgang Vögele war von Beginn an ihr Vorsitzender. Kurz nach dem Eintritt in den Ruhestand übernahm der Jurist und ehemalige Richter einer großen Jugendstrafkammer am Landgericht Stuttgart den Vorsitz und die Leitung der Unabhängigen Kommission und hatte ihn über 10 Jahre inne. In dieser Zeit hat die Kommission über 210 Anträge von Betroffenen aus Landeskirche und Diakonie geprüft und entschieden.
Vögele sagt über die Arbeit der Kommission: „Es geht hier weder um Schmerzensgeld noch um Schadenswiedergutmachung ... Es geht darum, dass das Leid der Betroffenen anerkannt wird.“ Viele der Betroffenen hat Wolfgang Vögele persönlich angehört, sich für sie Zeit genommen und sie auch nach der Anerkennung in allen denkbaren Lebensfragen und -situationen beraten und begleitet. Vögele sagt dazu: „Die Betroffenen sind von den Tätern darauf konditioniert, dass sie selbst schuld sind, dass ihnen ohnehin niemand glaubt und sie nichts wert sind. Und bei uns ist das auf einmal anders. Weil sie von uns nicht verhört wurden. Weil sie sich nicht rechtfertigen mussten. Weil sie uns nichts beweisen mussten. Weil die Kommission ihnen glaubte.“ Auch war es das Ziel von Vögele und der Kommission, „in diesen Gesprächen das ernsthafte Bemühen der Landeskirche, um einen inneren Ausgleich mit den Opfern sexualisierter Gewalt deutlich zu machen.“ Wichtig war ihm hierbei vor allem auch die Unabhängigkeit der Kommissionsmitglieder, die kein Arbeitsverhältnis mit der Landeskirche verband.
Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl würdigte das Engagement Vögeles folgendermaßen: „Mit hoher Sensibilität und dem Blick eines erfahrenen Juristen hat Herr Vögele entscheidend dazu beigetragen, dass das Leid der von Sexualisierter Gewalt Betroffenen in der Württembergischen Landeskirche und Diakonie Gehör und Anerkennung findet.“
Zu den Aufgaben als Vorsitzender der Unabhängigen Kommission zählten außerdem das Erstellen einer Geschäftsordnung, regelmäßige Gespräche mit der Leitung der Landeskirche bzw. dem Landesbischof, Treffen aller Vorsitzenden auf Ebene der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) sowie der enge Kontakt mit der Fachstelle sexualisierte Gewalt im Oberkirchenrat. Auch bei den von Landeskirche und Diakonie durchgeführten Betroffenenforen im Evangelischen Bildungszentrum Hospitalhof Stuttgart nahm Wolfgang Vögele teil und stellte seine Expertise und Zeit für alle Betroffenen und Mitarbeitenden zur Verfügung.
Bei all diesen Aufgaben brachte der langjährige Vorsitzende und ehemalige Jugendrichter auch seine über 35-jährige Berufserfahrung ein, vor allem, wenn es um juristische und politische Fragestellungen ging. Seine zugewandte, besonnen-verbindliche und auch humorvolle Art kam allen zugute, in der Sache konnte er aber auch hart und konsequent entscheiden.
Über die Brenz-Medaille:
Die nach dem württembergischen Reformator Johannes Brenz (1499 – 1570) benannte Brenz-Medaille wird von der Evangelischen Landeskirche in Württemberg seit 1992 in den Stufen Bronze und Silber für besondere Verdienste verliehen. Erster Preisträger war 1992 der Erzbischof von Canterbury, George Leonard Carey.
Hier werden externe Inhalte des (Dritt-)Anbieters ‘Meta Platforms - Instagram’ (Zweck: Soziale Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit) bereitgestellt. Mit Aktivierung des Dienstes stimmen Sie der in unserer Datenschutzinformation und in unserem Consent-Tool beschriebenen Datenverarbeitung zu.
Beitrag auf Instagram
Hier werden externe Inhalte des (Dritt-)Anbieters ‘Facebook’ (Zweck: Soziale Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit) bereitgestellt. Mit Aktivierung des Dienstes stimmen Sie der in unserer Datenschutzinformation und in unserem Consent-Tool beschriebenen Datenverarbeitung zu.
Beitrag auf Facebook
TOP 01 Strategische Planung
Alle Themen der Tagung
⬆️ Zum Seitenanfang
✳️Landessynode kompakt: Die wichtigsten Themen im Überblick
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente:
- Grußworte
- Verabschiedung der Unabhängigen Kommission zur Gewährung von Leistungen in Anerkennung des Leids Betroffener sexualisierter Gewalt und Verleihung der Silbernen Brenz-Medaille an den Vorsitzenden Wolfgang Vögele
- TOP 01 Strategische Planung
- TOP 02 Planüberschreitungen und Jahresabschluss der landeskirchlichen Rechnung 2024
TOP 03 1. Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 mit Kirchlichem Gesetz - TOP 04 Trauung gleichgeschlechtlich liebender Ehepaare
- TOP 05
- TOP 06 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung und des Gottesdienstes anlässlich der Eheschließung (Beilage 145)
- TOP 07 Kirchliches Gesetz zur Ablösung des Diakonen- und Diakoninnengesetzes und zur Änderung des Württ. Pfarrergesetzes (Beilage 141)
- TOP 08 Kirchliches Gesetz zur Änderung von Dienstverpflichtungen (Beilage 140)
- TOP 09 Gottesdienstbuch für die Ev. Landeskirche in Württemberg, Zweiter Teil, Teilband Einführungen und Verabschiedungen
- TOP 10 Bericht über die Situation der verfolgten Christen in der Welt sowie der Menschen, die aus religiösen, rassistischen, politischen, ethnischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gründen unter Verfolgung leiden – Schwerpunkt auf Syrien, Kolumbien, Nigeria und Pakistan
- TOP 11 Berichte des Beauftragten für die Entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs und des Islambeauftragten
- TOP 12 Aktuelle Stunde
- TOP 13 Schlussbericht des Ausschusses für Mission, Ökumene und Entwicklung
- TOP 14 Schlussbericht des Finanzausschusses
- TOP 15 Schlussbericht des Ausschusses für Bildung und Jugend
- TOP 16 Änderung des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes
- TOP 17 Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 18 Bericht der Projektstelle für die Themen Rassismus und Antisemitismus/Populismus und Extremismus
- Bildergalerie:Impressionen der Herbsttagung
- TOP 19 Abschaffung der Aktuellen Stunde
- TOP 20 OIKOS und die AKSB
- TOP 21 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (Beilage 142)
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (144)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Kirchengemeindeordnung und weiterer Regelungen (Beilage 143)
- TOP 24 Schlussbericht des Rechtsausschusses
- TOP 25 Selbständige Anträge
- TOP 26 Förmliche Anfragen
- TOP 27 Schlussbericht des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung
- TOP 28 Schlussbericht des Theologischen Ausschusses
- TOP 29 Abschlussbericht des Projekts „Geistlich Leiten, vom Geist geleitet“
- TOP 30 Schlussbericht des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung
- TOP 31 „Raum geben“ - Zwischenbericht zu den Projekten „Aufbruch Quartier“ und „Aufbruch Wohnen“
- TOP 32 Abschlussbericht des Projekts „Zukunftsgutscheine”
- TOP 33 Zwischenbericht zum Fonds „#miteinander“
- TOP 34 Schlussbericht des Ausschusses für Diakonie
- TOP 35 Schlussbericht des Sonderausschusses für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte
- TOP 36 Abschluss der 16. Landessynode
- Gottesdienst mit Abendmahl in der Stiftskirche
Alle Themen der Tagung
⬆️ Zum Seitenanfang
✳️Landessynode kompakt: Die wichtigsten Themen im Überblick
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente:
- Grußworte
- Verabschiedung der Unabhängigen Kommission zur Gewährung von Leistungen in Anerkennung des Leids Betroffener sexualisierter Gewalt und Verleihung der Silbernen Brenz-Medaille an den Vorsitzenden Wolfgang Vögele
- TOP 01 Strategische Planung
- TOP 02 Planüberschreitungen und Jahresabschluss der landeskirchlichen Rechnung 2024
TOP 03 1. Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 mit Kirchlichem Gesetz - TOP 04 Trauung gleichgeschlechtlich liebender Ehepaare
- TOP 05
- TOP 06 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung und des Gottesdienstes anlässlich der Eheschließung (Beilage 145)
- TOP 07 Kirchliches Gesetz zur Ablösung des Diakonen- und Diakoninnengesetzes und zur Änderung des Württ. Pfarrergesetzes (Beilage 141)
- TOP 08 Kirchliches Gesetz zur Änderung von Dienstverpflichtungen (Beilage 140)
- TOP 09 Gottesdienstbuch für die Ev. Landeskirche in Württemberg, Zweiter Teil, Teilband Einführungen und Verabschiedungen
- TOP 10 Bericht über die Situation der verfolgten Christen in der Welt sowie der Menschen, die aus religiösen, rassistischen, politischen, ethnischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gründen unter Verfolgung leiden – Schwerpunkt auf Syrien, Kolumbien, Nigeria und Pakistan
- TOP 11 Berichte des Beauftragten für die Entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs und des Islambeauftragten
- TOP 12 Aktuelle Stunde
- TOP 13 Schlussbericht des Ausschusses für Mission, Ökumene und Entwicklung
- TOP 14 Schlussbericht des Finanzausschusses
- TOP 15 Schlussbericht des Ausschusses für Bildung und Jugend
- TOP 16 Änderung des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes
- TOP 17 Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 18 Bericht der Projektstelle für die Themen Rassismus und Antisemitismus/Populismus und Extremismus
- Bildergalerie:Impressionen der Herbsttagung
- TOP 19 Abschaffung der Aktuellen Stunde
- TOP 20 OIKOS und die AKSB
- TOP 21 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (Beilage 142)
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (144)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Kirchengemeindeordnung und weiterer Regelungen (Beilage 143)
- TOP 24 Schlussbericht des Rechtsausschusses
- TOP 25 Selbständige Anträge
- TOP 26 Förmliche Anfragen
- TOP 27 Schlussbericht des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung
- TOP 28 Schlussbericht des Theologischen Ausschusses
- TOP 29 Abschlussbericht des Projekts „Geistlich Leiten, vom Geist geleitet“
- TOP 30 Schlussbericht des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung
- TOP 31 „Raum geben“ - Zwischenbericht zu den Projekten „Aufbruch Quartier“ und „Aufbruch Wohnen“
- TOP 32 Abschlussbericht des Projekts „Zukunftsgutscheine”
- TOP 33 Zwischenbericht zum Fonds „#miteinander“
- TOP 34 Schlussbericht des Ausschusses für Diakonie
- TOP 35 Schlussbericht des Sonderausschusses für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte
- TOP 36 Abschluss der 16. Landessynode
- Gottesdienst mit Abendmahl in der Stiftskirche
Bericht des Oberkirchenrats

Direktor Werner dankte zu Beginn der Landessynode für die Gestaltung des Reformprozesses. Mit den Beschlüssen seien Probleme nicht auf kommende Generationen verschoben worden.
Als die wichtigsten Projekte in der Amtsperiode der 16. Landessynode, mit denen die Kirche auf Veränderungen in Kirche und Gesellschaft reagiere, nannte er:
- die Konsolidierung des Haushalts,
- den Neubau des Dienstgebäudes,
- die Verwaltungsstrukturreform,
- das OIKOS-Projekt,
- die Umsetzung des Klimaschutzprojektes,
- den Prozess der Bildungsgesamtplanung,
- die Umstellung auf das Neue Finanzwesen,
- die digitale Roadmap,
- den Pfarrplan.
Direktor Werner erläuterte Ziele, Herausforderungen und Stand der jeweiligen Projekte. Es gelte grundsätzlich festzustellen, so Stefan Werner, dass die Landeskirche an Mitgliedern, Einfluss und an Finanzstärke kleiner werde. Diese Herausforderung sei anzunehmen, denn die Gesellschaft brauche die frohe Botschaft dringender denn je.
Als Themen der kommenden Jahre habe das Kollegium folgende strategische Schwerpunkte festgestellt:
- die wachsende Bedeutung von KI,
- das kirchliche Projektmanagement unter engeren finanziellen Bedingungen,
- die Personalgewinnung.
Bei allen Reformen bleibe das Ziel der Kirche gleich: Die glaubwürdige Wiedergabe des lebendigen Evangeliums in unserer Zeit.
Den vollständigen Bericht zu TOP 01 finden Sie in der Klappbox oben: Dokumente zu Tagesordnungspunkt 01
Alle Themen der Tagung
⬆️ Zum Seitenanfang
✳️Landessynode kompakt: Die wichtigsten Themen im Überblick
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente:
- Grußworte
- Verabschiedung der Unabhängigen Kommission zur Gewährung von Leistungen in Anerkennung des Leids Betroffener sexualisierter Gewalt und Verleihung der Silbernen Brenz-Medaille an den Vorsitzenden Wolfgang Vögele
- TOP 01 Strategische Planung
- TOP 02 Planüberschreitungen und Jahresabschluss der landeskirchlichen Rechnung 2024
TOP 03 1. Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 mit Kirchlichem Gesetz - TOP 04 Trauung gleichgeschlechtlich liebender Ehepaare
- TOP 05
- TOP 06 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung und des Gottesdienstes anlässlich der Eheschließung (Beilage 145)
- TOP 07 Kirchliches Gesetz zur Ablösung des Diakonen- und Diakoninnengesetzes und zur Änderung des Württ. Pfarrergesetzes (Beilage 141)
- TOP 08 Kirchliches Gesetz zur Änderung von Dienstverpflichtungen (Beilage 140)
- TOP 09 Gottesdienstbuch für die Ev. Landeskirche in Württemberg, Zweiter Teil, Teilband Einführungen und Verabschiedungen
- TOP 10 Bericht über die Situation der verfolgten Christen in der Welt sowie der Menschen, die aus religiösen, rassistischen, politischen, ethnischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gründen unter Verfolgung leiden – Schwerpunkt auf Syrien, Kolumbien, Nigeria und Pakistan
- TOP 11 Berichte des Beauftragten für die Entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs und des Islambeauftragten
- TOP 12 Aktuelle Stunde
- TOP 13 Schlussbericht des Ausschusses für Mission, Ökumene und Entwicklung
- TOP 14 Schlussbericht des Finanzausschusses
- TOP 15 Schlussbericht des Ausschusses für Bildung und Jugend
- TOP 16 Änderung des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes
- TOP 17 Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 18 Bericht der Projektstelle für die Themen Rassismus und Antisemitismus/Populismus und Extremismus
- Bildergalerie:Impressionen der Herbsttagung
- TOP 19 Abschaffung der Aktuellen Stunde
- TOP 20 OIKOS und die AKSB
- TOP 21 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (Beilage 142)
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (144)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Kirchengemeindeordnung und weiterer Regelungen (Beilage 143)
- TOP 24 Schlussbericht des Rechtsausschusses
- TOP 25 Selbständige Anträge
- TOP 26 Förmliche Anfragen
- TOP 27 Schlussbericht des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung
- TOP 28 Schlussbericht des Theologischen Ausschusses
- TOP 29 Abschlussbericht des Projekts „Geistlich Leiten, vom Geist geleitet“
- TOP 30 Schlussbericht des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung
- TOP 31 „Raum geben“ - Zwischenbericht zu den Projekten „Aufbruch Quartier“ und „Aufbruch Wohnen“
- TOP 32 Abschlussbericht des Projekts „Zukunftsgutscheine”
- TOP 33 Zwischenbericht zum Fonds „#miteinander“
- TOP 34 Schlussbericht des Ausschusses für Diakonie
- TOP 35 Schlussbericht des Sonderausschusses für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte
- TOP 36 Abschluss der 16. Landessynode
- Gottesdienst mit Abendmahl in der Stiftskirche
Aussprache

Der Synodale Christoph Hillebrand (Dettingen am Albuch) bedankte sich, wie andere Synodale auch, für den Bericht, der betont habe, dass der Auftrag der Kirche im Vordergrund stehe, und erst danach der Erhalt der Institution. Ihm sei wichtig, die Weitergabe des Evangeliums jetzt als Aufgabe anzugehen, indem Möglichkeiten der Begegnung geschaffen würden, Gemeindemitglieder befähigt und begleitet würden, sagte er. Dies müsse auch bei der neuen Synode ganz oben auf dem Programm stehen.
Der Synodale Prof. Dr. Martin Plümicke (Reutlingen) betonte, dass er der Analyse des Berichts inhaltlich zustimme. Als Reaktion darauf müsse nun investiert werden, Aufbruch gewagt werden. Rückblickend merkte er an, dass hier auch in der Vergangenheit manche Chance vertan worden sei. Von der im Bericht angesprochenen Dezentralisierung nehme er praktisch nicht viel wahr, eher eine Zentralisierung.
Der Synodale Matthias Böhler (Besigheim) äußerte Enttäuschung, Ärger und Frust angesichts des Berichts. Wie einige andere Synodale vertrat er die Auffassung, dass es falsch sei, den Begriff der strategischen Planung aufzugeben. Dieser sei wichtig, um einen Abgleich der Vorstellungen von Kollegium und Synode vorzunehmen. Ferner fehle ihm ein Blick in die Basis. Er erlebe gerade dort eine hohe Motivation im Transformationsprozess. Zwar trügen die Pfarrpersonen die Hauptlast, aber gerade die Ehrenamtlichen brächten die Kirche nach vorne, und verdienten eine Würdigung, ihnen müsse man Zukunftsbilder schenken.
Zum Neubau des Oberkirchenrats merkte der Synodale Rainer Köpf (Backnang) an, dass er davon beeindruckt sei; das Gebäude bilde auch die Zukunftsorientierung ab und ermutige auch die Bezirke. Ihm selbst fehle aber der Bezug zu Württemberg, dazu, was die Landeskirche ausmache.
Die Synodale Marion Blessing (Holzgerlingen) kritisierte ebenfalls, dass der Blick zur Basis, zu den Ehrenamtlichen, im Bericht fehle. Ohne diese könne die Kirche aber nicht überleben. Es brauche hier mehr Beteiligungsmöglichkeiten.
Der Synodale Dr. Harry Jungbauer (Heidenheim) dankte besonders für den Punkt der Bildungsgesamtplanung im Bericht, und wies darauf hin, dass darin viel Innovation stecke. Er warf die Frage auf, ob eine Veränderung der Finanzierung, von der Kirchensteuer zu Mitgliedsbeiträgen, geplant sei.
Der Synodale Prof. Dr. Thomas Hörnig (Ludwigsburg) regte wie auch andere Synodale an, über neue Bezeichnungen nachzudenken, so könne der Oberkirchenrat auch als „Dienstleistungszentrum“ bezeichnet werden, um zu zeigen, dass man sich vom Obrigkeitsdenken entferne.
Der Synodale Ralf Walter (Herbrechtingen) sprach die Begriffe „Single Loop Learning“ und „Double Loop Learning“ aus der Organisationsentwicklung an. Während sich der eine innerhalb des Systems bewege, mittels Reformationen reagiere, schaue der andere von außen auf die Herausforderungen, was für die Kirche als Reformation zu verstehen sei. Die Herausforderung in der Gesellschaft sei, dass viele Menschen an nichts glaubten. Sie seien aber nicht unerreichbar, sondern es benötigt kleine, multiprofessionelle Einheiten. Die 17. Synode der Landeskirche müsse eine Synode der Reformation werden.
Der Synodale Dr. Hans-Ulrich Probst hob die enorme Herausforderung des Klimaschutzes hervor und sprach sich dafür aus, nicht aus dem Prozess auszusteigen. Hinsichtlich der Mündigkeit der Kirchengemeinden decke sich seine Erfahrung nicht mit dem vermittelten Bild; er nannte als Beispiel den Beitritt zu Demokratiebündnissen.
Der Synodale Dr. Markus Ehrmann (Rot am See) vermisste in dem Bericht Ziele und ihre Konkretisierung, eine Strategie, wie die Kirche ihrem Auftrag gerecht werden will. Ferner brauche es eine Kürzungsliste für Regelungen, die die Kirchengemeinden vor Ort einschränkten. Bei der Personalgewinnung gehe es auch um den Zugang von Pfarrpersonen, diesen müsse der Zugang erleichtert werden.
Der Synodale Kai Münzing (Dettingen an der Erms) erklärte, dass für ihn Wachstum nicht allein an der Mitgliederzahl zu messen sei; dies sei keine geistliche Sicht. Im Gegenteil sei etwa bei der Veranstaltung „Gründergeist“ viel Wachstum spürbar gewesen.
Für den Synodalen Götz Kanzleiter (Ostelsheim) fehlte im Bericht die diakonische Perspektive, der Blick darauf, was bedürftige Menschen bräuchten.
In seiner Erwiderung ging Direktor Werner auf die Kritik an der Einordnung des Berichts ein. Er habe sich über die Jahre schwergetan, „von oben“ strategische Erwägungen vorzugeben; auch im Kollegium werde die Vorsicht hinsichtlich von Visionen seitens der Kirchenleitung geteilt. Es sei sinnvoll, über den Charakter des Berichts nachzudenken. Strategie sollte jedoch auch jetzt nicht in Rechenschaft untergehen. Doch auf der letzten Sitzung der jetzigen Synode sei ein Blick darauf, was auf den Weg gebracht sei, angebracht. Die Punkte Klimaschutz, Oikos, Pfarrplan und digitale Roadmap enthielten enorme Innovationen. Strategische Erwägungen lägen auch in der Überlegung, ob Mitgliederwachstum zu erwarten sei, um wieder in eine andere gesellschaftliche Position zu gelangen. Eine Änderung der Finanzierung werde im Moment nicht verfolgt; das Thema sei aber in Finanzgremien präsent. Die Vorschläge zur Umbenennung des Oberkirchenrats nehme er mit.
Den vollständigen Bericht zu TOP 01 finden Sie in der Klappbox oben: Dokumente zu Tagesordnungspunkt 01
Hier werden externe Inhalte des (Dritt-)Anbieters ‘Meta Platforms - Instagram’ (Zweck: Soziale Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit) bereitgestellt. Mit Aktivierung des Dienstes stimmen Sie der in unserer Datenschutzinformation und in unserem Consent-Tool beschriebenen Datenverarbeitung zu.
Beitrag auf Instagram
Hier werden externe Inhalte des (Dritt-)Anbieters ‘Facebook’ (Zweck: Soziale Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit) bereitgestellt. Mit Aktivierung des Dienstes stimmen Sie der in unserer Datenschutzinformation und in unserem Consent-Tool beschriebenen Datenverarbeitung zu.
Beitrag auf Facebook
TOP 02 Planüberschreitungen und Jahresabschluss der landeskirchlichen Rechnung 2024
TOP 03 1. Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 mit Kirchlichem Gesetz
Alle Themen der Tagung
⬆️ Zum Seitenanfang
✳️Landessynode kompakt: Die wichtigsten Themen im Überblick
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente:
- Grußworte
- Verabschiedung der Unabhängigen Kommission zur Gewährung von Leistungen in Anerkennung des Leids Betroffener sexualisierter Gewalt und Verleihung der Silbernen Brenz-Medaille an den Vorsitzenden Wolfgang Vögele
- TOP 01 Strategische Planung
- TOP 02 Planüberschreitungen und Jahresabschluss der landeskirchlichen Rechnung 2024
TOP 03 1. Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 mit Kirchlichem Gesetz - TOP 04 Trauung gleichgeschlechtlich liebender Ehepaare
- TOP 05
- TOP 06 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung und des Gottesdienstes anlässlich der Eheschließung (Beilage 145)
- TOP 07 Kirchliches Gesetz zur Ablösung des Diakonen- und Diakoninnengesetzes und zur Änderung des Württ. Pfarrergesetzes (Beilage 141)
- TOP 08 Kirchliches Gesetz zur Änderung von Dienstverpflichtungen (Beilage 140)
- TOP 09 Gottesdienstbuch für die Ev. Landeskirche in Württemberg, Zweiter Teil, Teilband Einführungen und Verabschiedungen
- TOP 10 Bericht über die Situation der verfolgten Christen in der Welt sowie der Menschen, die aus religiösen, rassistischen, politischen, ethnischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gründen unter Verfolgung leiden – Schwerpunkt auf Syrien, Kolumbien, Nigeria und Pakistan
- TOP 11 Berichte des Beauftragten für die Entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs und des Islambeauftragten
- TOP 12 Aktuelle Stunde
- TOP 13 Schlussbericht des Ausschusses für Mission, Ökumene und Entwicklung
- TOP 14 Schlussbericht des Finanzausschusses
- TOP 15 Schlussbericht des Ausschusses für Bildung und Jugend
- TOP 16 Änderung des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes
- TOP 17 Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 18 Bericht der Projektstelle für die Themen Rassismus und Antisemitismus/Populismus und Extremismus
- Bildergalerie:Impressionen der Herbsttagung
- TOP 19 Abschaffung der Aktuellen Stunde
- TOP 20 OIKOS und die AKSB
- TOP 21 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (Beilage 142)
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (144)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Kirchengemeindeordnung und weiterer Regelungen (Beilage 143)
- TOP 24 Schlussbericht des Rechtsausschusses
- TOP 25 Selbständige Anträge
- TOP 26 Förmliche Anfragen
- TOP 27 Schlussbericht des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung
- TOP 28 Schlussbericht des Theologischen Ausschusses
- TOP 29 Abschlussbericht des Projekts „Geistlich Leiten, vom Geist geleitet“
- TOP 30 Schlussbericht des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung
- TOP 31 „Raum geben“ - Zwischenbericht zu den Projekten „Aufbruch Quartier“ und „Aufbruch Wohnen“
- TOP 32 Abschlussbericht des Projekts „Zukunftsgutscheine”
- TOP 33 Zwischenbericht zum Fonds „#miteinander“
- TOP 34 Schlussbericht des Ausschusses für Diakonie
- TOP 35 Schlussbericht des Sonderausschusses für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte
- TOP 36 Abschluss der 16. Landessynode
- Gottesdienst mit Abendmahl in der Stiftskirche
Dokumente zu Tagesordnungspunkt 02/03
Alle Themen der Tagung
⬆️ Zum Seitenanfang
✳️Landessynode kompakt: Die wichtigsten Themen im Überblick
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente:
- Grußworte
- Verabschiedung der Unabhängigen Kommission zur Gewährung von Leistungen in Anerkennung des Leids Betroffener sexualisierter Gewalt und Verleihung der Silbernen Brenz-Medaille an den Vorsitzenden Wolfgang Vögele
- TOP 01 Strategische Planung
- TOP 02 Planüberschreitungen und Jahresabschluss der landeskirchlichen Rechnung 2024
TOP 03 1. Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 mit Kirchlichem Gesetz - TOP 04 Trauung gleichgeschlechtlich liebender Ehepaare
- TOP 05
- TOP 06 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung und des Gottesdienstes anlässlich der Eheschließung (Beilage 145)
- TOP 07 Kirchliches Gesetz zur Ablösung des Diakonen- und Diakoninnengesetzes und zur Änderung des Württ. Pfarrergesetzes (Beilage 141)
- TOP 08 Kirchliches Gesetz zur Änderung von Dienstverpflichtungen (Beilage 140)
- TOP 09 Gottesdienstbuch für die Ev. Landeskirche in Württemberg, Zweiter Teil, Teilband Einführungen und Verabschiedungen
- TOP 10 Bericht über die Situation der verfolgten Christen in der Welt sowie der Menschen, die aus religiösen, rassistischen, politischen, ethnischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gründen unter Verfolgung leiden – Schwerpunkt auf Syrien, Kolumbien, Nigeria und Pakistan
- TOP 11 Berichte des Beauftragten für die Entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs und des Islambeauftragten
- TOP 12 Aktuelle Stunde
- TOP 13 Schlussbericht des Ausschusses für Mission, Ökumene und Entwicklung
- TOP 14 Schlussbericht des Finanzausschusses
- TOP 15 Schlussbericht des Ausschusses für Bildung und Jugend
- TOP 16 Änderung des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes
- TOP 17 Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 18 Bericht der Projektstelle für die Themen Rassismus und Antisemitismus/Populismus und Extremismus
- Bildergalerie:Impressionen der Herbsttagung
- TOP 19 Abschaffung der Aktuellen Stunde
- TOP 20 OIKOS und die AKSB
- TOP 21 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (Beilage 142)
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (144)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Kirchengemeindeordnung und weiterer Regelungen (Beilage 143)
- TOP 24 Schlussbericht des Rechtsausschusses
- TOP 25 Selbständige Anträge
- TOP 26 Förmliche Anfragen
- TOP 27 Schlussbericht des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung
- TOP 28 Schlussbericht des Theologischen Ausschusses
- TOP 29 Abschlussbericht des Projekts „Geistlich Leiten, vom Geist geleitet“
- TOP 30 Schlussbericht des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung
- TOP 31 „Raum geben“ - Zwischenbericht zu den Projekten „Aufbruch Quartier“ und „Aufbruch Wohnen“
- TOP 32 Abschlussbericht des Projekts „Zukunftsgutscheine”
- TOP 33 Zwischenbericht zum Fonds „#miteinander“
- TOP 34 Schlussbericht des Ausschusses für Diakonie
- TOP 35 Schlussbericht des Sonderausschusses für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte
- TOP 36 Abschluss der 16. Landessynode
- Gottesdienst mit Abendmahl in der Stiftskirche
Dokumente zu Tagesordnungspunkt 02/03
Bericht des Oberkirchenrats

Jahresabschluss 2024
Oberkirchenrat Dr. Fabian Peters, Leiter des Dezernats für Finanzmanagement und Informationstechnologie, erläuterte zunächst den Jahresabschluss 2024 und hob hervor, dass trotz geringerer Kirchensteuereinnahmen (26,9 Mio. Euro unter Plan) der geplante Fehlbetrag des Ergebnishaushalts von 104,3 Mio. Euro deutlich unterschritten werden konnte. Dazu hätten unter anderem beigetragen:
- ein höheres Zinsniveau (13,5 Mio. Euro über Plan);
- niedrigere Personalkosten (19,5 Mio. Euro unter Plan);
- geringere Sachkosten (38,8 Mio. Euro unter Plan);
Keine echte Einsparung seien die 60,6 Mio. Euro, die laut Plan ursprünglich an die Stiftung Versorgungsfonds hätten übertragen werden sollen. Nach Beschluss der neuen Versorgungsdeckungsstrategie durch die Landessynode werden diese Mittel jedoch nicht mehr an die Stiftung gegeben, sondern im Aktivvermögen der Landeskirche angespart, so Peters.
Um diese Summe bereinigt schnitte das ordentliche Ergebnis 2024 operativ um 29,5 Mio. Euro schlechter ab als 2023, so Peters: „Während wir in den Jahren 2022 und 2023 jeweils Überschüsse erzielen konnten, steht für 2024 ein echter Fehlbetrag zu Buche.“ Im Finanzhaushalt, also dem tatsächlich zahlungswirksamen Teil des Haushalts, wäre – so Peters – im Plan ein Fehlbetrag von rund 90 Millionen Euro erwartet worden. Tatsächlich sei jedoch einen Finanzmittelüberschuss von 36,4 Millionen Euro erzielt worden. Die Ursachen entsprächen im Wesentlichen denen des Ergebnishaushalts.
Die Bilanzsumme der Landeskirche habe zum 31.12.2024 bei gut 3 Mrd. Euro gelegen, so Peters. Die Aufschlüsselung nach Aktiva und Passiva entnehmen Sie bitte dem schriftlichen Bericht in den Dokumenten zu diesem Tagesordnungspunkt.
Nachtrag zum Haushaltsjahr 2026 – Umsetzung der Sparbeschlüsse
Einleitend erinnerte Peters daran, dass die Landessynode sich bei der Sommertagung 2025 „intensiv und abschließend mit dem Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategieprozess beschäftigt und die Einsparungen von jährlich 103,9 Millionen Euro auf den Weg gebracht“ habe. Dabei sei eine detaillierte Priorisierungsliste beschlossen worden, die konkret benenne, wo, ab wann, wie viel zu sparen sei. Diese politisch beschlossenen Einsparungen würden nun haushaltsrechtlich umgesetzt, soweit sie das Haushaltsjahr 2026 betreffen.
Peters ging insbesondere auf die Aufgabe der Tagungsstätte Bernhäuser Forst ein, für die der Nachtragshaushalt die Rahmenbedingungen schaffe. Geplant sei die Übergabe der Tagungsstätte an den CVJM-Gesamtverband Deutschland zum 1. Juni 2026. Um diese Übergabe zu ermöglichen, bitte der Oberkirchenrat um die nötigen haushaltsrechtlichen Ermächtigungen:
- die Ermächtigung, Grundstück und Gebäude unentgeltlich an den CVJM bzw. einen noch zu gründenden Rechtsträger zu übergeben;
- die außerordentliche Abschreibung des Restbuchwerts von Grundstücken und Gebäuden;
- die Gewährung eines Zuschusses in Höhe von 3 Mio. Euro für nötige Investitionen;
- Sperrung der Planansätze auf der Zuweisungskostenstelle sowie im Sonderhaushaltsplan ab dem Zeitpunkt des Betriebsübergangs.
Im Gegenzug verpflichte sich der CVJM, die bisherige Nutzung für mindestens zehn Jahre fortzuführen und aller Beschäftigten zu übernehmen. Der Finanzausschuss habe dem bereits zugestimmt.
Zur Verteilung der Kirchensteuer 2026 erklärte Peters folgende Veränderungen gegenüber dem ursprünglichen Plan:
- Der Verteilbetrag, der aus dem Kirchengemeindeanteil der Kirchensteuer direkt an diese geht, sowie der Beitrag zum Ausgleichsstock der Kirchengemeinden bleiben nahezu unverändert.
- Der Vorwegabzug reduziert sich um 1,1 Millionen Euro aufgrund eines reduzierten EKD-Finanzausgleichs.
- Die Zuführung zur Ausgleichsrücklage der Kirchengemeinden erhöht sich um rund 5 Millionen Euro.
Die sogenannten “weiteren Erträge” steigen laut Peters gegenüber Plan um 24,6 Mio. Euro – hauptsächlich, weil im Zuge der Verwaltungsstrukturreform Stellen von den Kirchengemeinden in den landeskirchlichen Haushalt verlagert werden und die Kosten dafür der Landeskirche voll erstattet werden. Dem stehen allerdings die zusätzlichen Personalkosten entgegen, die sich aufgrund der beschlossenen Einsparungen auf der Aufwandsseite nur mit 20,2 Mio. Euro auswirken. Das ordentliche Ergebnis werde gegenüber dem ursprünglichen Plan um 3,5 Mio. Euro besser ausfallen.
Abschließend würdigte Peters das „vertrauensvolle, fehlerfreundliche und konstruktive Miteinander“ von Landessynode und Oberkirchenrat: „104 Millionen Euro strukturelle Einsparungen zusätzlich zu den Einsparungen im Pfarrdienst sind keine alltägliche Aufgabe. Dass uns das als Landessynode, als Kollegium und mit den Mitarbeitenden im Oberkirchenrat gelungen ist – und wir uns dabei weiterhin offen und respektvoll in die Augen schauen können – ist für mich ein kleines Wunder.“ Jetzt gelte es „umzusetzen, was die Haushaltspläne sagen“.
Den vollständigen Bericht zu TOP 02/03 finden Sie in der Klappbox oben: Dokumente zu Tagesordnungspunkt 02/03
Alle Themen der Tagung
⬆️ Zum Seitenanfang
✳️Landessynode kompakt: Die wichtigsten Themen im Überblick
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente:
- Grußworte
- Verabschiedung der Unabhängigen Kommission zur Gewährung von Leistungen in Anerkennung des Leids Betroffener sexualisierter Gewalt und Verleihung der Silbernen Brenz-Medaille an den Vorsitzenden Wolfgang Vögele
- TOP 01 Strategische Planung
- TOP 02 Planüberschreitungen und Jahresabschluss der landeskirchlichen Rechnung 2024
TOP 03 1. Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 mit Kirchlichem Gesetz - TOP 04 Trauung gleichgeschlechtlich liebender Ehepaare
- TOP 05
- TOP 06 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung und des Gottesdienstes anlässlich der Eheschließung (Beilage 145)
- TOP 07 Kirchliches Gesetz zur Ablösung des Diakonen- und Diakoninnengesetzes und zur Änderung des Württ. Pfarrergesetzes (Beilage 141)
- TOP 08 Kirchliches Gesetz zur Änderung von Dienstverpflichtungen (Beilage 140)
- TOP 09 Gottesdienstbuch für die Ev. Landeskirche in Württemberg, Zweiter Teil, Teilband Einführungen und Verabschiedungen
- TOP 10 Bericht über die Situation der verfolgten Christen in der Welt sowie der Menschen, die aus religiösen, rassistischen, politischen, ethnischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gründen unter Verfolgung leiden – Schwerpunkt auf Syrien, Kolumbien, Nigeria und Pakistan
- TOP 11 Berichte des Beauftragten für die Entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs und des Islambeauftragten
- TOP 12 Aktuelle Stunde
- TOP 13 Schlussbericht des Ausschusses für Mission, Ökumene und Entwicklung
- TOP 14 Schlussbericht des Finanzausschusses
- TOP 15 Schlussbericht des Ausschusses für Bildung und Jugend
- TOP 16 Änderung des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes
- TOP 17 Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 18 Bericht der Projektstelle für die Themen Rassismus und Antisemitismus/Populismus und Extremismus
- Bildergalerie:Impressionen der Herbsttagung
- TOP 19 Abschaffung der Aktuellen Stunde
- TOP 20 OIKOS und die AKSB
- TOP 21 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (Beilage 142)
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (144)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Kirchengemeindeordnung und weiterer Regelungen (Beilage 143)
- TOP 24 Schlussbericht des Rechtsausschusses
- TOP 25 Selbständige Anträge
- TOP 26 Förmliche Anfragen
- TOP 27 Schlussbericht des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung
- TOP 28 Schlussbericht des Theologischen Ausschusses
- TOP 29 Abschlussbericht des Projekts „Geistlich Leiten, vom Geist geleitet“
- TOP 30 Schlussbericht des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung
- TOP 31 „Raum geben“ - Zwischenbericht zu den Projekten „Aufbruch Quartier“ und „Aufbruch Wohnen“
- TOP 32 Abschlussbericht des Projekts „Zukunftsgutscheine”
- TOP 33 Zwischenbericht zum Fonds „#miteinander“
- TOP 34 Schlussbericht des Ausschusses für Diakonie
- TOP 35 Schlussbericht des Sonderausschusses für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte
- TOP 36 Abschluss der 16. Landessynode
- Gottesdienst mit Abendmahl in der Stiftskirche
Dokumente zu Tagesordnungspunkt 02/03
Bericht des Finanzausschusses mit Antrag Nr. 28/25

Jahresabschluss 2024
Tobias Geiger, Vorsitzender des Finanzausschusses, erklärte in seinem Bericht, der Jahresabschluss 2024 sei für ihn „eine Art Faktencheck, ob wir die Herausforderungen begriffen und entsprechende Weichenstellungen vorgenommen haben.“ Aus Sicht des Finanzausschusses werden Landeskirche und Landessynode im „eingeschlagenen Weg der Haushaltskonsolidierung und Versorgungsdeckung bestätigt. Was wir uns vorgenommen haben, entspricht der Realität der Zahlen aus dem vergangenen Haushaltsjahr.“
Geiger führte den Kirchensteuerrückgang im Jahresabschluss 2024 auf „die schlechte wirtschaftliche Entwicklung in Baden-Württemberg“ zurück sowie auf den „anhaltend hohen Mitgliederverlust, 2023 und 2024 sind jeweils über 30.000 Menschen ausgetreten“.
Mit Blick auf die gesunkenen Personal- und Sachkosten bescheinigte Geiger den Bewirtschaftern „Haushaltsdisziplin und Ausgabenvernunft“. Die Einsparungen zeigten, „dass die in der Priorisierungsliste vorgegeben Sparziele nicht aus der Luft gegriffen, sondern tatsächlich umsetzbar sind“.
Hinsichtlich des ordentlichen Ergebnisses 2024 von minus 9,8 Mio. Euro frage sich vielleicht „der eine oder die andere Synodale: Wenn am Ende 10 Mio. Euro fehlen – wieso müssen wir dann bis 2028 mit der Priorisierungsliste 103,9 Mio. Euro jährlich einsparen?“ Geiger erläuterte, im Ergebnis seien nicht besetzte Personalstellen (-19,5 Mio. Euro) und nicht verbrauchter Sachaufwand (-38,8 Mio. Euro) eingerechnet. Ohne diese Minderausgaben gäbe es statt minus 9,8 Mio. Euro einen Fehlbetrag von 68,3 Mio Euro. Die Priorisierungsliste schreibe solche Minderausgaben dauerhaft als Einsparungen fest. Hinzu komme, „dass unsere Personalausgaben in den kommenden Jahren deutlich stärker wachsen werden als die Einnahmen über die Kirchensteuer. Der dadurch entstehende Fehlbetrag ist in den 103,9 Mio. Euro der Priorisierungsliste ebenfalls schon perspektivisch enthalten.“
Nachtrag zum Haushaltsjahr 2026
Mit Blick auf die vier Tagungsstätten der Landeskirche (Birkach, Bad Boll, Urach und Bernhäuser Forst) sei die Hoffnung auf „eine schwarze Null“ im Laufe der Jahre verloren gegangen. Auf Bitte der Synode habe deshalb der Oberkirchenrat eine Tagungsstättenkonzeption erarbeitet mit der Vorgabe, bis 2030 zwei der Häuser aufzugeben. Haus Birkach werde zum Ende dieses Jahres geschlossen. Für die dort angesiedelten Bildungseinrichtungen seien alternative Standorte gefunden worden, so dass Haus Birkach verkauft oder vermietet werden könne.
Die Abgabe des Bernhäuser Forst an den CVJM sei für die Landeskirche „der sprichwörtliche Sechser im Lotto.“ Das Haus bleibe für die Freizeit- und Tagungsarbeit des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg nutzbar, während der CVJM-Gesamtverband eine entsprechende Expertise mitbringe und neue Belegungsmöglichkeiten erschließen könne. Die 3 Mio. Euro Zuschuss an den CVJM für notwendige Investitionen seien zwar „viel Geld“. Dies entspreche aber „in etwa der Summe, die wir bis 2030 als Minimum zu zahlen hätten“, wenn das Haus bei der Landeskirche bliebe. Deshalb habe der Finanzausschuss den Vertragsmodalitäten einstimmig zugestimmt. Geiger hob hervor, dass „bei einer Übergabe an den CVJM-Gesamtverband alle Mitarbeitenden ihre Arbeitsplätze“ behalten würden.
Abschließend erklärte Geiger, der Finanzausschuss habe einstimmig beschlossen, der Landessynode die Zustimmung zum Nachtrag zu empfehlen.
Den vollständigen Bericht zu TOP 02/03 finden Sie in der Klappbox oben: Dokumente zu Tagesordnungspunkt 02/03
Alle Themen der Tagung
⬆️ Zum Seitenanfang
✳️Landessynode kompakt: Die wichtigsten Themen im Überblick
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente:
- Grußworte
- Verabschiedung der Unabhängigen Kommission zur Gewährung von Leistungen in Anerkennung des Leids Betroffener sexualisierter Gewalt und Verleihung der Silbernen Brenz-Medaille an den Vorsitzenden Wolfgang Vögele
- TOP 01 Strategische Planung
- TOP 02 Planüberschreitungen und Jahresabschluss der landeskirchlichen Rechnung 2024
TOP 03 1. Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 mit Kirchlichem Gesetz - TOP 04 Trauung gleichgeschlechtlich liebender Ehepaare
- TOP 05
- TOP 06 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung und des Gottesdienstes anlässlich der Eheschließung (Beilage 145)
- TOP 07 Kirchliches Gesetz zur Ablösung des Diakonen- und Diakoninnengesetzes und zur Änderung des Württ. Pfarrergesetzes (Beilage 141)
- TOP 08 Kirchliches Gesetz zur Änderung von Dienstverpflichtungen (Beilage 140)
- TOP 09 Gottesdienstbuch für die Ev. Landeskirche in Württemberg, Zweiter Teil, Teilband Einführungen und Verabschiedungen
- TOP 10 Bericht über die Situation der verfolgten Christen in der Welt sowie der Menschen, die aus religiösen, rassistischen, politischen, ethnischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gründen unter Verfolgung leiden – Schwerpunkt auf Syrien, Kolumbien, Nigeria und Pakistan
- TOP 11 Berichte des Beauftragten für die Entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs und des Islambeauftragten
- TOP 12 Aktuelle Stunde
- TOP 13 Schlussbericht des Ausschusses für Mission, Ökumene und Entwicklung
- TOP 14 Schlussbericht des Finanzausschusses
- TOP 15 Schlussbericht des Ausschusses für Bildung und Jugend
- TOP 16 Änderung des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes
- TOP 17 Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 18 Bericht der Projektstelle für die Themen Rassismus und Antisemitismus/Populismus und Extremismus
- Bildergalerie:Impressionen der Herbsttagung
- TOP 19 Abschaffung der Aktuellen Stunde
- TOP 20 OIKOS und die AKSB
- TOP 21 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (Beilage 142)
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (144)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Kirchengemeindeordnung und weiterer Regelungen (Beilage 143)
- TOP 24 Schlussbericht des Rechtsausschusses
- TOP 25 Selbständige Anträge
- TOP 26 Förmliche Anfragen
- TOP 27 Schlussbericht des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung
- TOP 28 Schlussbericht des Theologischen Ausschusses
- TOP 29 Abschlussbericht des Projekts „Geistlich Leiten, vom Geist geleitet“
- TOP 30 Schlussbericht des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung
- TOP 31 „Raum geben“ - Zwischenbericht zu den Projekten „Aufbruch Quartier“ und „Aufbruch Wohnen“
- TOP 32 Abschlussbericht des Projekts „Zukunftsgutscheine”
- TOP 33 Zwischenbericht zum Fonds „#miteinander“
- TOP 34 Schlussbericht des Ausschusses für Diakonie
- TOP 35 Schlussbericht des Sonderausschusses für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte
- TOP 36 Abschluss der 16. Landessynode
- Gottesdienst mit Abendmahl in der Stiftskirche
Dokumente zu Tagesordnungspunkt 02/03
Bericht des Ausschusses für die Verteilung der Mittel des Ausgleichstocks
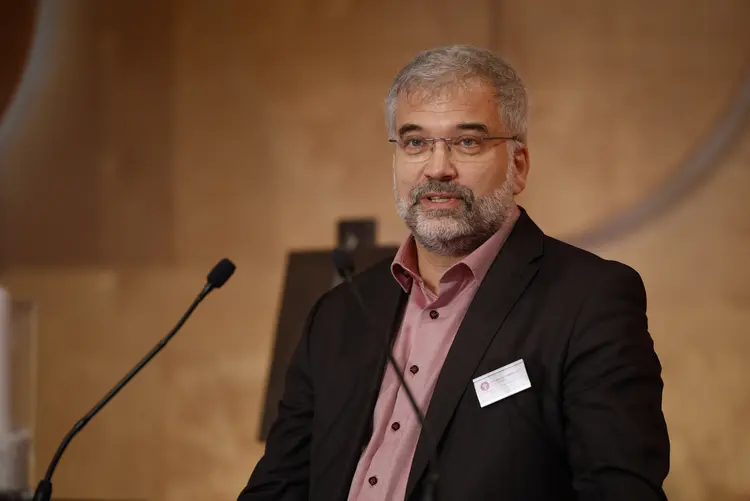
Jahresabschluss 2024
Hansjörg Frank, Vorsitzender des Ausschusses für die Verteilung der Mittel aus dem Ausgleichsstock, legte in seinem Bericht einen Schwerpunkt auf das OIKOS-Programm zur Bewertung der Nachhaltigkeit und Förderwürdigkeit kirchlicher Immobilien. OIKOS bewertet Immobilien in drei Kategorien. Frank erklärte, es gehe darum, „grün kategorisierte Gebäude maßvoll zu sanieren und energetisch zu ertüchtigen, gelb einsortierte denkmalgeschützte Kirchengebäude, wie auch beim Sonderförderprogramm Kirchensanierungen, beim Unterhalt in Dach und Fach zumindest außen zu unterstützen und rote Gebäude für künftige Baumaßnahmen im Einzelfall von der Bezuschussung auszuschließen.“
Auch beim Sonderförderprogramm Kirchensanierungen, beim Unterhalt in Dach und Fach zumindest außen zu unterstützen und rote Gebäude für künftige Baumaßnahmen im Einzelfall von der Bezuschussung auszuschließen.“ Der Grund: „Die finanziellen Mittel für die Sanierung des vollständigen derzeitigen Gebäudebestands werden künftig schlichtweg nicht ausreichen.“
Frank betonte, „dass ein rot kategorisiertes Gebäude nicht gleich morgen veräußert werden muss – aber die Kirchengemeinde bzw. die Eigentümer müssen sich über Folgendes im Klaren sein: Sie müssen sich darum kümmern, künftige Baumaßnahmen – ohne Zuweisungen aus dem Ausgleichstock – umzusetzen und bis 2040 eine Lösung für den CO2-Ausstoß zu finden.“
Des Weiteren sprach Frank über die Förderung der evangelischen Kindertagesstätten aus dem Ausgleichsstock: „In den Jahren 2023 und 2024 wurden Zuschüsse in Höhe von insgesamt rund 4,129 Mio. und 4,044 Mio. Euro ausgezahlt. Die in diesen Jahren (2023 und 2024) verdoppelten Zuweisungen je Gruppe zur Abmilderung der Effekte des Ukraine-Kriegs und der hohen Inflation wurde mit dem Haushaltsplan 2025/2026 wieder zurückgenommen.“
Über die Zuflüsse zum Ausgleichsstock sagte Frank: „Dem Ausgleichstock sind im Jahr 2024 plangemäß neben der allgemeinen Zuweisung in Höhe von 22.626.666 Euro […] weitere Mittel in Höhe von 4.200.000 Euro zur Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder (Betriebskosten) und 14.000.000 Euro zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen zugeflossen.“ Für gegebene Förderzusagen bei Großprojekten seien ca. 70. Mio. Euro aus dem Bestand ‚reserviert‘. Für alle übrigen noch nicht abgerechneten Vorhaben müsse mit wenigstens 30 Mio. Euro gerechnet werden.
Zur Vereinfachung der Verwaltung und zur Erleichterung des Verkaufs von Gebäuden seien die Erstattungsregelungen mit Wirkung vom 1. Januar 2024 angepasst worden. Dadurch könne der Ausgleichstock weniger Mittel vereinnahmen. 2024 sei ein Rückgang um etwa 50 Prozent zu verzeichnen gewesen.
Den vollständigen Bericht zu TOP 02/03 finden Sie in der Klappbox oben: Dokumente zu Tagesordnungspunkt 02/03
Alle Themen der Tagung
⬆️ Zum Seitenanfang
✳️Landessynode kompakt: Die wichtigsten Themen im Überblick
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente:
- Grußworte
- Verabschiedung der Unabhängigen Kommission zur Gewährung von Leistungen in Anerkennung des Leids Betroffener sexualisierter Gewalt und Verleihung der Silbernen Brenz-Medaille an den Vorsitzenden Wolfgang Vögele
- TOP 01 Strategische Planung
- TOP 02 Planüberschreitungen und Jahresabschluss der landeskirchlichen Rechnung 2024
TOP 03 1. Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 mit Kirchlichem Gesetz - TOP 04 Trauung gleichgeschlechtlich liebender Ehepaare
- TOP 05
- TOP 06 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung und des Gottesdienstes anlässlich der Eheschließung (Beilage 145)
- TOP 07 Kirchliches Gesetz zur Ablösung des Diakonen- und Diakoninnengesetzes und zur Änderung des Württ. Pfarrergesetzes (Beilage 141)
- TOP 08 Kirchliches Gesetz zur Änderung von Dienstverpflichtungen (Beilage 140)
- TOP 09 Gottesdienstbuch für die Ev. Landeskirche in Württemberg, Zweiter Teil, Teilband Einführungen und Verabschiedungen
- TOP 10 Bericht über die Situation der verfolgten Christen in der Welt sowie der Menschen, die aus religiösen, rassistischen, politischen, ethnischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gründen unter Verfolgung leiden – Schwerpunkt auf Syrien, Kolumbien, Nigeria und Pakistan
- TOP 11 Berichte des Beauftragten für die Entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs und des Islambeauftragten
- TOP 12 Aktuelle Stunde
- TOP 13 Schlussbericht des Ausschusses für Mission, Ökumene und Entwicklung
- TOP 14 Schlussbericht des Finanzausschusses
- TOP 15 Schlussbericht des Ausschusses für Bildung und Jugend
- TOP 16 Änderung des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes
- TOP 17 Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 18 Bericht der Projektstelle für die Themen Rassismus und Antisemitismus/Populismus und Extremismus
- Bildergalerie:Impressionen der Herbsttagung
- TOP 19 Abschaffung der Aktuellen Stunde
- TOP 20 OIKOS und die AKSB
- TOP 21 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (Beilage 142)
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (144)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Kirchengemeindeordnung und weiterer Regelungen (Beilage 143)
- TOP 24 Schlussbericht des Rechtsausschusses
- TOP 25 Selbständige Anträge
- TOP 26 Förmliche Anfragen
- TOP 27 Schlussbericht des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung
- TOP 28 Schlussbericht des Theologischen Ausschusses
- TOP 29 Abschlussbericht des Projekts „Geistlich Leiten, vom Geist geleitet“
- TOP 30 Schlussbericht des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung
- TOP 31 „Raum geben“ - Zwischenbericht zu den Projekten „Aufbruch Quartier“ und „Aufbruch Wohnen“
- TOP 32 Abschlussbericht des Projekts „Zukunftsgutscheine”
- TOP 33 Zwischenbericht zum Fonds „#miteinander“
- TOP 34 Schlussbericht des Ausschusses für Diakonie
- TOP 35 Schlussbericht des Sonderausschusses für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte
- TOP 36 Abschluss der 16. Landessynode
- Gottesdienst mit Abendmahl in der Stiftskirche
Dokumente zu Tagesordnungspunkt 02/03
Grundsatzaussprache

Eckart Schultz-Berg (Stuttgart) sagte, der Nachtragshaushalt schmerze. Aber die Sommersynode habe dies intensiv diskutiert, und nun sei er gespannt, „wie sich das weiterentwickelt“. Wichtig sei ihm klarzustellen, dass die Einsparungen um rund 104 Mio. Euro nicht die Kirchengemeinden betreffen. Hinsichtlich der Rückstellungen für die Versorgung der Kirchenbeamten im Haushalt statt in der Versorgungsstiftung sei ihm wichtig, dass diese Gelder sicher reserviert seien. Zu den Tagungsstätten sagte Schultz-Berg, es bewege ihn, dass die Häuser weiter funktionieren können.
Ulrike Sämann (Plochingen) fragte, weshalb der Bernhäuser Forst unentgeltlich abgegeben werden solle. Oberkirchenrat Dr. Fabian Peters erklärte dies damit, dass es schwierig sei, einen neuen Träger für ein defizitäres Haus zu finden. Er gab zudem zu bedenken, dass der CVJM das Haus nicht als Geldanlage verwenden könne, sondern die Arbeit für Kinder-, Jugend- und Familienarbeit fortsetze. Dies werde vertraglich festgelegt. Deshalb habe das Haus keinen Wert als Geldanlage.
Jörg Schaal (Weissach im Tal) ging auf die Diskussion über einen Umbau der Finanzierung der Kirche ein und gab zu bedenken, es sei ein Blick in die Glaskugel, was dabei herauskommen würde. Mit Blick auf die Tagungshäuser sagte Schaal, jede kirchliche Gruppe werde weiter einen Ort zum Tagen finden.
Götz Kanzleiter (Ostelsheim) plädierte dafür, über neue Wege der Kirchenfinanzierung nachzudenken, denn die Stimmung in Gesellschaft und Politik gehe in diese Richtung.
Dr. Harry Jungbauer (Heidenheim) gab in einem Zwischenruf zu bedenken, es gebe durchaus Synodalkandidierende, die explizit für ein Ende der Kirchensteuer eintreten.
Kai Münzing (Dettingen an der Erms) bat in einem Zwischenruf darum, die Aussprache nicht für Wahlkampf zu nutzen, sondern zur Sache zu sprechen.
Oberkirchenrat Dr. Fabian Peters ging abschließend auf einige Äußerungen der Aussprache ein:
- Die Gelder, die statt im Versorgungsfond nun im Haushalt verwaltet würden, seien durch juristische Mechanismen gut für die Versorgungszwecke gesichert.
- Das System der Finanzierung durch Kirchensteuer sei sehr ergiebig, und Kirchen in aller Welt beneideten die deutschen Kirchen um dieses System. Es erlaube der Kirche so viele Möglichkeiten der Verkündigung wie sie keine andere Kirche habe. Zudem gebe es Länder ohne Kirchensteuer, in denen die Austrittszahlen noch deutlich höher seien.
- Zur Frage einer Spendenfinanzierung wies Peters darauf hin, dass in Deutschland beide großen Kirchen zusammen jährlich 12 Mrd. Euro Kirchensteuer erhalten – das gesamte Spendenaufkommen in Deutschland für alle Zwecke liege hingegen bei nur 6 Mrd. Euro.
Den vollständigen Bericht zu TOP 02/03 finden Sie in der Klappbox oben: Dokumente zu Tagesordnungspunkt 02/03
Alle Themen der Tagung
⬆️ Zum Seitenanfang
✳️Landessynode kompakt: Die wichtigsten Themen im Überblick
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente:
- Grußworte
- Verabschiedung der Unabhängigen Kommission zur Gewährung von Leistungen in Anerkennung des Leids Betroffener sexualisierter Gewalt und Verleihung der Silbernen Brenz-Medaille an den Vorsitzenden Wolfgang Vögele
- TOP 01 Strategische Planung
- TOP 02 Planüberschreitungen und Jahresabschluss der landeskirchlichen Rechnung 2024
TOP 03 1. Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 mit Kirchlichem Gesetz - TOP 04 Trauung gleichgeschlechtlich liebender Ehepaare
- TOP 05
- TOP 06 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung und des Gottesdienstes anlässlich der Eheschließung (Beilage 145)
- TOP 07 Kirchliches Gesetz zur Ablösung des Diakonen- und Diakoninnengesetzes und zur Änderung des Württ. Pfarrergesetzes (Beilage 141)
- TOP 08 Kirchliches Gesetz zur Änderung von Dienstverpflichtungen (Beilage 140)
- TOP 09 Gottesdienstbuch für die Ev. Landeskirche in Württemberg, Zweiter Teil, Teilband Einführungen und Verabschiedungen
- TOP 10 Bericht über die Situation der verfolgten Christen in der Welt sowie der Menschen, die aus religiösen, rassistischen, politischen, ethnischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gründen unter Verfolgung leiden – Schwerpunkt auf Syrien, Kolumbien, Nigeria und Pakistan
- TOP 11 Berichte des Beauftragten für die Entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs und des Islambeauftragten
- TOP 12 Aktuelle Stunde
- TOP 13 Schlussbericht des Ausschusses für Mission, Ökumene und Entwicklung
- TOP 14 Schlussbericht des Finanzausschusses
- TOP 15 Schlussbericht des Ausschusses für Bildung und Jugend
- TOP 16 Änderung des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes
- TOP 17 Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 18 Bericht der Projektstelle für die Themen Rassismus und Antisemitismus/Populismus und Extremismus
- Bildergalerie:Impressionen der Herbsttagung
- TOP 19 Abschaffung der Aktuellen Stunde
- TOP 20 OIKOS und die AKSB
- TOP 21 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (Beilage 142)
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (144)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Kirchengemeindeordnung und weiterer Regelungen (Beilage 143)
- TOP 24 Schlussbericht des Rechtsausschusses
- TOP 25 Selbständige Anträge
- TOP 26 Förmliche Anfragen
- TOP 27 Schlussbericht des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung
- TOP 28 Schlussbericht des Theologischen Ausschusses
- TOP 29 Abschlussbericht des Projekts „Geistlich Leiten, vom Geist geleitet“
- TOP 30 Schlussbericht des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung
- TOP 31 „Raum geben“ - Zwischenbericht zu den Projekten „Aufbruch Quartier“ und „Aufbruch Wohnen“
- TOP 32 Abschlussbericht des Projekts „Zukunftsgutscheine”
- TOP 33 Zwischenbericht zum Fonds „#miteinander“
- TOP 34 Schlussbericht des Ausschusses für Diakonie
- TOP 35 Schlussbericht des Sonderausschusses für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte
- TOP 36 Abschluss der 16. Landessynode
- Gottesdienst mit Abendmahl in der Stiftskirche
Dokumente zu Tagesordnungspunkt 02/03
Beschluss zu TOP 02
Den Jahresabschluss der landeskirchlichen Rechnung 2024 hat die Landessynode mit großer Mehrheit genehmigt.
Den vollständigen Bericht zu TOP 02/03 finden Sie in der Klappbox oben: Dokumente zu Tagesordnungspunkt 02/03
Alle Themen der Tagung
⬆️ Zum Seitenanfang
✳️Landessynode kompakt: Die wichtigsten Themen im Überblick
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente:
- Grußworte
- Verabschiedung der Unabhängigen Kommission zur Gewährung von Leistungen in Anerkennung des Leids Betroffener sexualisierter Gewalt und Verleihung der Silbernen Brenz-Medaille an den Vorsitzenden Wolfgang Vögele
- TOP 01 Strategische Planung
- TOP 02 Planüberschreitungen und Jahresabschluss der landeskirchlichen Rechnung 2024
TOP 03 1. Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 mit Kirchlichem Gesetz - TOP 04 Trauung gleichgeschlechtlich liebender Ehepaare
- TOP 05
- TOP 06 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung und des Gottesdienstes anlässlich der Eheschließung (Beilage 145)
- TOP 07 Kirchliches Gesetz zur Ablösung des Diakonen- und Diakoninnengesetzes und zur Änderung des Württ. Pfarrergesetzes (Beilage 141)
- TOP 08 Kirchliches Gesetz zur Änderung von Dienstverpflichtungen (Beilage 140)
- TOP 09 Gottesdienstbuch für die Ev. Landeskirche in Württemberg, Zweiter Teil, Teilband Einführungen und Verabschiedungen
- TOP 10 Bericht über die Situation der verfolgten Christen in der Welt sowie der Menschen, die aus religiösen, rassistischen, politischen, ethnischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gründen unter Verfolgung leiden – Schwerpunkt auf Syrien, Kolumbien, Nigeria und Pakistan
- TOP 11 Berichte des Beauftragten für die Entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs und des Islambeauftragten
- TOP 12 Aktuelle Stunde
- TOP 13 Schlussbericht des Ausschusses für Mission, Ökumene und Entwicklung
- TOP 14 Schlussbericht des Finanzausschusses
- TOP 15 Schlussbericht des Ausschusses für Bildung und Jugend
- TOP 16 Änderung des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes
- TOP 17 Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 18 Bericht der Projektstelle für die Themen Rassismus und Antisemitismus/Populismus und Extremismus
- Bildergalerie:Impressionen der Herbsttagung
- TOP 19 Abschaffung der Aktuellen Stunde
- TOP 20 OIKOS und die AKSB
- TOP 21 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (Beilage 142)
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (144)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Kirchengemeindeordnung und weiterer Regelungen (Beilage 143)
- TOP 24 Schlussbericht des Rechtsausschusses
- TOP 25 Selbständige Anträge
- TOP 26 Förmliche Anfragen
- TOP 27 Schlussbericht des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung
- TOP 28 Schlussbericht des Theologischen Ausschusses
- TOP 29 Abschlussbericht des Projekts „Geistlich Leiten, vom Geist geleitet“
- TOP 30 Schlussbericht des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung
- TOP 31 „Raum geben“ - Zwischenbericht zu den Projekten „Aufbruch Quartier“ und „Aufbruch Wohnen“
- TOP 32 Abschlussbericht des Projekts „Zukunftsgutscheine”
- TOP 33 Zwischenbericht zum Fonds „#miteinander“
- TOP 34 Schlussbericht des Ausschusses für Diakonie
- TOP 35 Schlussbericht des Sonderausschusses für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte
- TOP 36 Abschluss der 16. Landessynode
- Gottesdienst mit Abendmahl in der Stiftskirche
Dokumente zu Tagesordnungspunkt 02/03
Beschluss zu TOP 03
Antrag Nr. 28/25 über den Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 mit Kirchlichem Gesetz hat die Landessynode ebenfalls in erster und zweiter Lesung mit großer Mehrheit verabschiedet.
Den vollständigen Bericht zu TOP 02/03 finden Sie in der Klappbox oben: Dokumente zu Tagesordnungspunkt 02/03
Hier werden externe Inhalte des (Dritt-)Anbieters ‘Meta Platforms - Instagram’ (Zweck: Soziale Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit) bereitgestellt. Mit Aktivierung des Dienstes stimmen Sie der in unserer Datenschutzinformation und in unserem Consent-Tool beschriebenen Datenverarbeitung zu.
Beitrag auf Instagram
Hier werden externe Inhalte des (Dritt-)Anbieters ‘Facebook’ (Zweck: Soziale Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit) bereitgestellt. Mit Aktivierung des Dienstes stimmen Sie der in unserer Datenschutzinformation und in unserem Consent-Tool beschriebenen Datenverarbeitung zu.
Beitrag auf Facebook
TOP 04 Trauung gleichgeschlechtlich liebender Ehepaare
Alle Themen der Tagung
⬆️ Zum Seitenanfang
✳️Landessynode kompakt: Die wichtigsten Themen im Überblick
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente:
- Grußworte
- Verabschiedung der Unabhängigen Kommission zur Gewährung von Leistungen in Anerkennung des Leids Betroffener sexualisierter Gewalt und Verleihung der Silbernen Brenz-Medaille an den Vorsitzenden Wolfgang Vögele
- TOP 01 Strategische Planung
- TOP 02 Planüberschreitungen und Jahresabschluss der landeskirchlichen Rechnung 2024
TOP 03 1. Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 mit Kirchlichem Gesetz - TOP 04 Trauung gleichgeschlechtlich liebender Ehepaare
- TOP 05
- TOP 06 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung und des Gottesdienstes anlässlich der Eheschließung (Beilage 145)
- TOP 07 Kirchliches Gesetz zur Ablösung des Diakonen- und Diakoninnengesetzes und zur Änderung des Württ. Pfarrergesetzes (Beilage 141)
- TOP 08 Kirchliches Gesetz zur Änderung von Dienstverpflichtungen (Beilage 140)
- TOP 09 Gottesdienstbuch für die Ev. Landeskirche in Württemberg, Zweiter Teil, Teilband Einführungen und Verabschiedungen
- TOP 10 Bericht über die Situation der verfolgten Christen in der Welt sowie der Menschen, die aus religiösen, rassistischen, politischen, ethnischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gründen unter Verfolgung leiden – Schwerpunkt auf Syrien, Kolumbien, Nigeria und Pakistan
- TOP 11 Berichte des Beauftragten für die Entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs und des Islambeauftragten
- TOP 12 Aktuelle Stunde
- TOP 13 Schlussbericht des Ausschusses für Mission, Ökumene und Entwicklung
- TOP 14 Schlussbericht des Finanzausschusses
- TOP 15 Schlussbericht des Ausschusses für Bildung und Jugend
- TOP 16 Änderung des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes
- TOP 17 Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 18 Bericht der Projektstelle für die Themen Rassismus und Antisemitismus/Populismus und Extremismus
- Bildergalerie:Impressionen der Herbsttagung
- TOP 19 Abschaffung der Aktuellen Stunde
- TOP 20 OIKOS und die AKSB
- TOP 21 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (Beilage 142)
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (144)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Kirchengemeindeordnung und weiterer Regelungen (Beilage 143)
- TOP 24 Schlussbericht des Rechtsausschusses
- TOP 25 Selbständige Anträge
- TOP 26 Förmliche Anfragen
- TOP 27 Schlussbericht des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung
- TOP 28 Schlussbericht des Theologischen Ausschusses
- TOP 29 Abschlussbericht des Projekts „Geistlich Leiten, vom Geist geleitet“
- TOP 30 Schlussbericht des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung
- TOP 31 „Raum geben“ - Zwischenbericht zu den Projekten „Aufbruch Quartier“ und „Aufbruch Wohnen“
- TOP 32 Abschlussbericht des Projekts „Zukunftsgutscheine”
- TOP 33 Zwischenbericht zum Fonds „#miteinander“
- TOP 34 Schlussbericht des Ausschusses für Diakonie
- TOP 35 Schlussbericht des Sonderausschusses für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte
- TOP 36 Abschluss der 16. Landessynode
- Gottesdienst mit Abendmahl in der Stiftskirche
Alle Themen der Tagung
⬆️ Zum Seitenanfang
✳️Landessynode kompakt: Die wichtigsten Themen im Überblick
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente:
- Grußworte
- Verabschiedung der Unabhängigen Kommission zur Gewährung von Leistungen in Anerkennung des Leids Betroffener sexualisierter Gewalt und Verleihung der Silbernen Brenz-Medaille an den Vorsitzenden Wolfgang Vögele
- TOP 01 Strategische Planung
- TOP 02 Planüberschreitungen und Jahresabschluss der landeskirchlichen Rechnung 2024
TOP 03 1. Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 mit Kirchlichem Gesetz - TOP 04 Trauung gleichgeschlechtlich liebender Ehepaare
- TOP 05
- TOP 06 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung und des Gottesdienstes anlässlich der Eheschließung (Beilage 145)
- TOP 07 Kirchliches Gesetz zur Ablösung des Diakonen- und Diakoninnengesetzes und zur Änderung des Württ. Pfarrergesetzes (Beilage 141)
- TOP 08 Kirchliches Gesetz zur Änderung von Dienstverpflichtungen (Beilage 140)
- TOP 09 Gottesdienstbuch für die Ev. Landeskirche in Württemberg, Zweiter Teil, Teilband Einführungen und Verabschiedungen
- TOP 10 Bericht über die Situation der verfolgten Christen in der Welt sowie der Menschen, die aus religiösen, rassistischen, politischen, ethnischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gründen unter Verfolgung leiden – Schwerpunkt auf Syrien, Kolumbien, Nigeria und Pakistan
- TOP 11 Berichte des Beauftragten für die Entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs und des Islambeauftragten
- TOP 12 Aktuelle Stunde
- TOP 13 Schlussbericht des Ausschusses für Mission, Ökumene und Entwicklung
- TOP 14 Schlussbericht des Finanzausschusses
- TOP 15 Schlussbericht des Ausschusses für Bildung und Jugend
- TOP 16 Änderung des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes
- TOP 17 Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 18 Bericht der Projektstelle für die Themen Rassismus und Antisemitismus/Populismus und Extremismus
- Bildergalerie:Impressionen der Herbsttagung
- TOP 19 Abschaffung der Aktuellen Stunde
- TOP 20 OIKOS und die AKSB
- TOP 21 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (Beilage 142)
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (144)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Kirchengemeindeordnung und weiterer Regelungen (Beilage 143)
- TOP 24 Schlussbericht des Rechtsausschusses
- TOP 25 Selbständige Anträge
- TOP 26 Förmliche Anfragen
- TOP 27 Schlussbericht des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung
- TOP 28 Schlussbericht des Theologischen Ausschusses
- TOP 29 Abschlussbericht des Projekts „Geistlich Leiten, vom Geist geleitet“
- TOP 30 Schlussbericht des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung
- TOP 31 „Raum geben“ - Zwischenbericht zu den Projekten „Aufbruch Quartier“ und „Aufbruch Wohnen“
- TOP 32 Abschlussbericht des Projekts „Zukunftsgutscheine”
- TOP 33 Zwischenbericht zum Fonds „#miteinander“
- TOP 34 Schlussbericht des Ausschusses für Diakonie
- TOP 35 Schlussbericht des Sonderausschusses für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte
- TOP 36 Abschluss der 16. Landessynode
- Gottesdienst mit Abendmahl in der Stiftskirche
Bericht des Rechtsausschusses

Christoph Müller, Vorsitzender des Rechtsausschusses, fasste in seinem Bericht den bisherigen Verlauf der Gespräche über den Antrag 23/23 zusammen. Dieser sei in der Sommersynode 2023 eingebracht worden. In der darauffolgenden Sitzung des Rechtsausschusses habe es deutlichen Widerstand gegen den Antrag gegeben. Im April 2024 habe sich der Ausschuss für ein weiteres Verfolgen des Antrags ausgesprochen. Im Frühjahr 2025 sei eine neue Fassung des Gesetzes durch den Oberkirchenrat eingebracht worden. Weiterhin wäre in einigen Punkten aber keine Einigung möglich gewesen. So wäre die Bezeichnung – Trauung oder Segnung – weiter strittig. Ebenso sei nach wie vor umstritten, ob die Gemeinden sich weiterhin aktiv für solche Gottesdienste entscheiden und die Genehmigung beantragen müssten, oder ob sie künftig grundsätzlich erlaubt sein sollen, Gemeinden sich aber dagegen entscheiden könnten.
Daher hab man entschieden, dass die Vorsitzenden und Stellvertretenden Vorsitzenden des Rechts- und des Theologischen Ausschusses mit dem Oberkirchenrat Eckpunkte einer dritten Fassung erarbeiten würden. Diese würden unter TOP 6 vorgestellt werden.
Den vollständigen Bericht zu TOP 04 finden Sie in der Klappbox oben: Dokumente zu Tagesordnungspunkt 04
Alle Themen der Tagung
⬆️ Zum Seitenanfang
✳️Landessynode kompakt: Die wichtigsten Themen im Überblick
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente:
- Grußworte
- Verabschiedung der Unabhängigen Kommission zur Gewährung von Leistungen in Anerkennung des Leids Betroffener sexualisierter Gewalt und Verleihung der Silbernen Brenz-Medaille an den Vorsitzenden Wolfgang Vögele
- TOP 01 Strategische Planung
- TOP 02 Planüberschreitungen und Jahresabschluss der landeskirchlichen Rechnung 2024
TOP 03 1. Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 mit Kirchlichem Gesetz - TOP 04 Trauung gleichgeschlechtlich liebender Ehepaare
- TOP 05
- TOP 06 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung und des Gottesdienstes anlässlich der Eheschließung (Beilage 145)
- TOP 07 Kirchliches Gesetz zur Ablösung des Diakonen- und Diakoninnengesetzes und zur Änderung des Württ. Pfarrergesetzes (Beilage 141)
- TOP 08 Kirchliches Gesetz zur Änderung von Dienstverpflichtungen (Beilage 140)
- TOP 09 Gottesdienstbuch für die Ev. Landeskirche in Württemberg, Zweiter Teil, Teilband Einführungen und Verabschiedungen
- TOP 10 Bericht über die Situation der verfolgten Christen in der Welt sowie der Menschen, die aus religiösen, rassistischen, politischen, ethnischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gründen unter Verfolgung leiden – Schwerpunkt auf Syrien, Kolumbien, Nigeria und Pakistan
- TOP 11 Berichte des Beauftragten für die Entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs und des Islambeauftragten
- TOP 12 Aktuelle Stunde
- TOP 13 Schlussbericht des Ausschusses für Mission, Ökumene und Entwicklung
- TOP 14 Schlussbericht des Finanzausschusses
- TOP 15 Schlussbericht des Ausschusses für Bildung und Jugend
- TOP 16 Änderung des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes
- TOP 17 Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 18 Bericht der Projektstelle für die Themen Rassismus und Antisemitismus/Populismus und Extremismus
- Bildergalerie:Impressionen der Herbsttagung
- TOP 19 Abschaffung der Aktuellen Stunde
- TOP 20 OIKOS und die AKSB
- TOP 21 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (Beilage 142)
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (144)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Kirchengemeindeordnung und weiterer Regelungen (Beilage 143)
- TOP 24 Schlussbericht des Rechtsausschusses
- TOP 25 Selbständige Anträge
- TOP 26 Förmliche Anfragen
- TOP 27 Schlussbericht des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung
- TOP 28 Schlussbericht des Theologischen Ausschusses
- TOP 29 Abschlussbericht des Projekts „Geistlich Leiten, vom Geist geleitet“
- TOP 30 Schlussbericht des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung
- TOP 31 „Raum geben“ - Zwischenbericht zu den Projekten „Aufbruch Quartier“ und „Aufbruch Wohnen“
- TOP 32 Abschlussbericht des Projekts „Zukunftsgutscheine”
- TOP 33 Zwischenbericht zum Fonds „#miteinander“
- TOP 34 Schlussbericht des Ausschusses für Diakonie
- TOP 35 Schlussbericht des Sonderausschusses für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte
- TOP 36 Abschluss der 16. Landessynode
- Gottesdienst mit Abendmahl in der Stiftskirche
Bericht des Theologischen Ausschusses
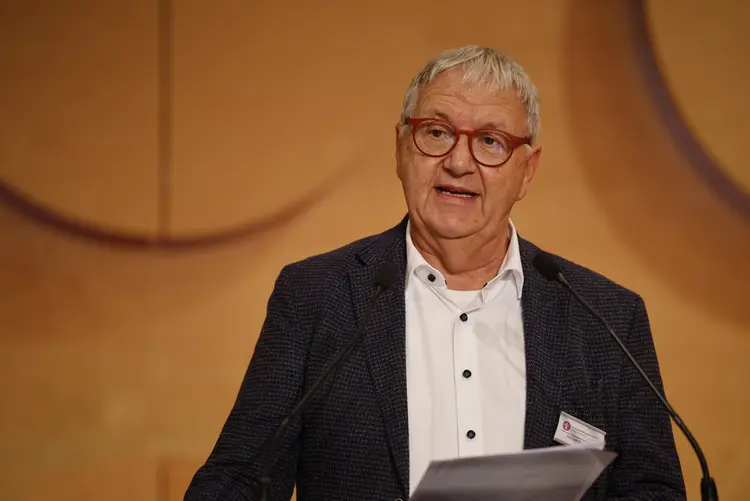
Hellger Koepff, Vorsitzender des Theologischen Ausschusses, ergänzte die Ausführungen aus Sicht des Theologischen Ausschusses. Demnach würde nicht versucht werden, eine gemeinsame Position zur Trauung gleichgeschlechtlich liebender Ehepaare zu finden, sondern ein Umgang mit den verschiedenen Auslegungen. Abseits der Diskussion um die biblischen Quellen, die schon seit vielen Jahrzehnten geführt würde, wäre auch die Bedeutung der kirchlichen Trauung zu beachten. Da der Staat, nicht die Kirche, die Ehe schlösse, wäre der Traugottesdienst in jedem Fall ein Gottesdienst anlässlich der bereits vollzogenen Trauung.
Um den aktuellen Stand der Diskussion festzuhalten, hätten Koepff und sein Stellvertreter, Steffen Kern, ein Statement verfasst. Dieses habe der Rechtsausschuss als Präambel für den neuen Entwurf vorgesehen.
Den vollständigen Bericht zu TOP 04 finden Sie in der Klappbox oben: Dokumente zu Tagesordnungspunkt 04
TOP 05
TOP 06 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung und des Gottesdienstes anlässlich der Eheschließung (Beilage 145)
Alle Themen der Tagung
⬆️ Zum Seitenanfang
✳️Landessynode kompakt: Die wichtigsten Themen im Überblick
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente:
- Grußworte
- Verabschiedung der Unabhängigen Kommission zur Gewährung von Leistungen in Anerkennung des Leids Betroffener sexualisierter Gewalt und Verleihung der Silbernen Brenz-Medaille an den Vorsitzenden Wolfgang Vögele
- TOP 01 Strategische Planung
- TOP 02 Planüberschreitungen und Jahresabschluss der landeskirchlichen Rechnung 2024
TOP 03 1. Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 mit Kirchlichem Gesetz - TOP 04 Trauung gleichgeschlechtlich liebender Ehepaare
- TOP 05
- TOP 06 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung und des Gottesdienstes anlässlich der Eheschließung (Beilage 145)
- TOP 07 Kirchliches Gesetz zur Ablösung des Diakonen- und Diakoninnengesetzes und zur Änderung des Württ. Pfarrergesetzes (Beilage 141)
- TOP 08 Kirchliches Gesetz zur Änderung von Dienstverpflichtungen (Beilage 140)
- TOP 09 Gottesdienstbuch für die Ev. Landeskirche in Württemberg, Zweiter Teil, Teilband Einführungen und Verabschiedungen
- TOP 10 Bericht über die Situation der verfolgten Christen in der Welt sowie der Menschen, die aus religiösen, rassistischen, politischen, ethnischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gründen unter Verfolgung leiden – Schwerpunkt auf Syrien, Kolumbien, Nigeria und Pakistan
- TOP 11 Berichte des Beauftragten für die Entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs und des Islambeauftragten
- TOP 12 Aktuelle Stunde
- TOP 13 Schlussbericht des Ausschusses für Mission, Ökumene und Entwicklung
- TOP 14 Schlussbericht des Finanzausschusses
- TOP 15 Schlussbericht des Ausschusses für Bildung und Jugend
- TOP 16 Änderung des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes
- TOP 17 Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 18 Bericht der Projektstelle für die Themen Rassismus und Antisemitismus/Populismus und Extremismus
- Bildergalerie:Impressionen der Herbsttagung
- TOP 19 Abschaffung der Aktuellen Stunde
- TOP 20 OIKOS und die AKSB
- TOP 21 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (Beilage 142)
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (144)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Kirchengemeindeordnung und weiterer Regelungen (Beilage 143)
- TOP 24 Schlussbericht des Rechtsausschusses
- TOP 25 Selbständige Anträge
- TOP 26 Förmliche Anfragen
- TOP 27 Schlussbericht des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung
- TOP 28 Schlussbericht des Theologischen Ausschusses
- TOP 29 Abschlussbericht des Projekts „Geistlich Leiten, vom Geist geleitet“
- TOP 30 Schlussbericht des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung
- TOP 31 „Raum geben“ - Zwischenbericht zu den Projekten „Aufbruch Quartier“ und „Aufbruch Wohnen“
- TOP 32 Abschlussbericht des Projekts „Zukunftsgutscheine”
- TOP 33 Zwischenbericht zum Fonds „#miteinander“
- TOP 34 Schlussbericht des Ausschusses für Diakonie
- TOP 35 Schlussbericht des Sonderausschusses für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte
- TOP 36 Abschluss der 16. Landessynode
- Gottesdienst mit Abendmahl in der Stiftskirche
Dokumente zu Tagesordnungspunkt 06
Alle Themen der Tagung
⬆️ Zum Seitenanfang
✳️Landessynode kompakt: Die wichtigsten Themen im Überblick
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente:
- Grußworte
- Verabschiedung der Unabhängigen Kommission zur Gewährung von Leistungen in Anerkennung des Leids Betroffener sexualisierter Gewalt und Verleihung der Silbernen Brenz-Medaille an den Vorsitzenden Wolfgang Vögele
- TOP 01 Strategische Planung
- TOP 02 Planüberschreitungen und Jahresabschluss der landeskirchlichen Rechnung 2024
TOP 03 1. Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 mit Kirchlichem Gesetz - TOP 04 Trauung gleichgeschlechtlich liebender Ehepaare
- TOP 05
- TOP 06 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung und des Gottesdienstes anlässlich der Eheschließung (Beilage 145)
- TOP 07 Kirchliches Gesetz zur Ablösung des Diakonen- und Diakoninnengesetzes und zur Änderung des Württ. Pfarrergesetzes (Beilage 141)
- TOP 08 Kirchliches Gesetz zur Änderung von Dienstverpflichtungen (Beilage 140)
- TOP 09 Gottesdienstbuch für die Ev. Landeskirche in Württemberg, Zweiter Teil, Teilband Einführungen und Verabschiedungen
- TOP 10 Bericht über die Situation der verfolgten Christen in der Welt sowie der Menschen, die aus religiösen, rassistischen, politischen, ethnischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gründen unter Verfolgung leiden – Schwerpunkt auf Syrien, Kolumbien, Nigeria und Pakistan
- TOP 11 Berichte des Beauftragten für die Entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs und des Islambeauftragten
- TOP 12 Aktuelle Stunde
- TOP 13 Schlussbericht des Ausschusses für Mission, Ökumene und Entwicklung
- TOP 14 Schlussbericht des Finanzausschusses
- TOP 15 Schlussbericht des Ausschusses für Bildung und Jugend
- TOP 16 Änderung des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes
- TOP 17 Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 18 Bericht der Projektstelle für die Themen Rassismus und Antisemitismus/Populismus und Extremismus
- Bildergalerie:Impressionen der Herbsttagung
- TOP 19 Abschaffung der Aktuellen Stunde
- TOP 20 OIKOS und die AKSB
- TOP 21 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (Beilage 142)
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (144)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Kirchengemeindeordnung und weiterer Regelungen (Beilage 143)
- TOP 24 Schlussbericht des Rechtsausschusses
- TOP 25 Selbständige Anträge
- TOP 26 Förmliche Anfragen
- TOP 27 Schlussbericht des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung
- TOP 28 Schlussbericht des Theologischen Ausschusses
- TOP 29 Abschlussbericht des Projekts „Geistlich Leiten, vom Geist geleitet“
- TOP 30 Schlussbericht des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung
- TOP 31 „Raum geben“ - Zwischenbericht zu den Projekten „Aufbruch Quartier“ und „Aufbruch Wohnen“
- TOP 32 Abschlussbericht des Projekts „Zukunftsgutscheine”
- TOP 33 Zwischenbericht zum Fonds „#miteinander“
- TOP 34 Schlussbericht des Ausschusses für Diakonie
- TOP 35 Schlussbericht des Sonderausschusses für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte
- TOP 36 Abschluss der 16. Landessynode
- Gottesdienst mit Abendmahl in der Stiftskirche
Dokumente zu Tagesordnungspunkt 06
Bericht des Rechtsausschusses

Der Vorsitzende des Rechtsausschusses, Christoph Müller, erläuterte den Entwurf zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung und des Gottesdienstes anlässlich der Eheschließung. Danach sollen zwei Bücher eingeführt werden, von denen das eine die Trauung anlässlich der Eheschließung von Mann und Frau, das andere die Trauung anlässlich der Eheschließung von zwei Personen gleichen Geschlechts und in gleichgestellten Fällen regelt. Beides sei somit eine kirchliche Trauung. Eine Ehe im kirchlich biblischen Sinne werde damit jedoch nicht für alle geschlossen.
Wie bisher gebe es keine flächendeckende Einführung; bis zu einem Viertel der Kirchengemeinden könne die örtliche Gottesdienstordnung ändern. Das Verfahren hierzu werde einfacher gestaltet. Wie bisher soll die Landessynode über eine landeskirchliche Agende diskutieren, nachdem ein Viertel der Kirchengemeinden ihre Gottesdienstordnung geändert haben.
Der Theologische Ausschuss habe die Präambel des vorliegenden Entwurfs erarbeitet.
Der Rechtsausschuss legt den Entwurf der Synode zur Verabschiedung vor.
Den vollständigen Bericht zu TOP 06 finden Sie in der Klappbox oben: Dokumente zu Tagesordnungspunkt 06
Alle Themen der Tagung
⬆️ Zum Seitenanfang
✳️Landessynode kompakt: Die wichtigsten Themen im Überblick
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente:
- Grußworte
- Verabschiedung der Unabhängigen Kommission zur Gewährung von Leistungen in Anerkennung des Leids Betroffener sexualisierter Gewalt und Verleihung der Silbernen Brenz-Medaille an den Vorsitzenden Wolfgang Vögele
- TOP 01 Strategische Planung
- TOP 02 Planüberschreitungen und Jahresabschluss der landeskirchlichen Rechnung 2024
TOP 03 1. Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 mit Kirchlichem Gesetz - TOP 04 Trauung gleichgeschlechtlich liebender Ehepaare
- TOP 05
- TOP 06 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung und des Gottesdienstes anlässlich der Eheschließung (Beilage 145)
- TOP 07 Kirchliches Gesetz zur Ablösung des Diakonen- und Diakoninnengesetzes und zur Änderung des Württ. Pfarrergesetzes (Beilage 141)
- TOP 08 Kirchliches Gesetz zur Änderung von Dienstverpflichtungen (Beilage 140)
- TOP 09 Gottesdienstbuch für die Ev. Landeskirche in Württemberg, Zweiter Teil, Teilband Einführungen und Verabschiedungen
- TOP 10 Bericht über die Situation der verfolgten Christen in der Welt sowie der Menschen, die aus religiösen, rassistischen, politischen, ethnischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gründen unter Verfolgung leiden – Schwerpunkt auf Syrien, Kolumbien, Nigeria und Pakistan
- TOP 11 Berichte des Beauftragten für die Entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs und des Islambeauftragten
- TOP 12 Aktuelle Stunde
- TOP 13 Schlussbericht des Ausschusses für Mission, Ökumene und Entwicklung
- TOP 14 Schlussbericht des Finanzausschusses
- TOP 15 Schlussbericht des Ausschusses für Bildung und Jugend
- TOP 16 Änderung des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes
- TOP 17 Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 18 Bericht der Projektstelle für die Themen Rassismus und Antisemitismus/Populismus und Extremismus
- Bildergalerie:Impressionen der Herbsttagung
- TOP 19 Abschaffung der Aktuellen Stunde
- TOP 20 OIKOS und die AKSB
- TOP 21 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (Beilage 142)
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (144)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Kirchengemeindeordnung und weiterer Regelungen (Beilage 143)
- TOP 24 Schlussbericht des Rechtsausschusses
- TOP 25 Selbständige Anträge
- TOP 26 Förmliche Anfragen
- TOP 27 Schlussbericht des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung
- TOP 28 Schlussbericht des Theologischen Ausschusses
- TOP 29 Abschlussbericht des Projekts „Geistlich Leiten, vom Geist geleitet“
- TOP 30 Schlussbericht des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung
- TOP 31 „Raum geben“ - Zwischenbericht zu den Projekten „Aufbruch Quartier“ und „Aufbruch Wohnen“
- TOP 32 Abschlussbericht des Projekts „Zukunftsgutscheine”
- TOP 33 Zwischenbericht zum Fonds „#miteinander“
- TOP 34 Schlussbericht des Ausschusses für Diakonie
- TOP 35 Schlussbericht des Sonderausschusses für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte
- TOP 36 Abschluss der 16. Landessynode
- Gottesdienst mit Abendmahl in der Stiftskirche
Dokumente zu Tagesordnungspunkt 06

Aussprache
Hellger Koepff (Biberach) sagte in seiner Funktion als Vorsitzender des theologischen Ausschusses, im Grunde ändere der vorgelegte Gesetzentwurf nicht viel. Es gehe um Verfahrenserleichterungen und um den Begriff der Trauung, der künftig durchgängig für alle Gottesdienste anlässlich der Eheschließung gelten solle. Wesentlich sei, ob der Entwurf für die Ruhe in der Kirche sorgen könne, nach der sich viele sehnten.
Burkhard Frauer (Ditzingen) dankte den Vertretern und Vertreterinnen von Bunt fürs Leben, die trotz schmerzlicher persönlicher Betroffenheit bei den Tagungen der Synode immer da und offen für Gespräche seien. Er danke auch für die Bemühung um eine gemeinsame Lösung, doch es sei kein wirklich befriedigendes Ergebnis, denn auch der aktuelle Entwurf mit seiner Opt-In-Regelung lege die Ehe von Mann und Frau als Normalfall fest. Der Wechsel vom Begriff der Segnung zu dem der Trauung sei für manche schwierig. Frauer wies darauf hin, dass die Trauung aber auch ein Gottesdienst aus Anlass der bürgerlichen Eheschließung sei. Er sei überzeugt, dass die Trauung für alle kommen werde, es werde keine Ruhe geben.
Bernd Wetzel (Brackenheim) verlas eine stark gekürzte Version des Textes von Hellger Koepff und Steffen Kern, die er mit ChatGPT erstellt hat. Der Texte betone die Einheit in der Vielfalt der Auslegungen.
Amrei Steinfort (Hechingen) sagte, die theologischen Argumente seien seit Jahrzehnten ausgetauscht. Beide Positionen eine der Wunsch, die Ehe zu stärken. Steinfort betonte, Liebe gebe es “nur brutto” und berichtete von einem queeren Gottesdienst unter dem biblischen Motto “du bist wunderbar gemacht” und der Erfahrung des Angenommenseins, die queere Menschen in diesem Gottesdienst gemacht hätten. Sie warb für den Antrag und dafür “großherzig zu sein”.
Christiane Mörk (Brackenheim) betonte, der Begriff “Trauung” bedeutet den queeren Paaren viel. Der Entwurf sei ein weiterer Schritt in Richtung einer queerfreundlichen Kirche. Das sei wichtig in einer zunehmend queerfeindlichen Gesellschaft. Es brauche eine Ethik der Lebensformen.
Renate Schweikle (Kirchheim unter Teck) warb dafür, in dieser Frage von Jesus zu lernen. Alle Menschen seien in die Heilsgemeinschaft gerufen. Jesus habe gerade die Menschen gerufen, denen andere in seiner Zeit die Gottesnähe abgesprochen hätten. Sie sagte: “Grenzt niemand vom Reich Gottes aus.”
Matthias Hanßmann (Horb a. N.) betonte, die Debatte gehe an die Nieren, das spreche der Entwurf an. Er stellte fest, die Lösung, die 2019 gefunden worden sei, sei schon ein Kompromiss. Er sei ein Paradigmenwechsel gewesen, der die Entscheidung in die Gemeinden gegeben habe. Das aktuelle Gesetz sehe vor, sich wieder mit dem Thema zu befassen, wenn 25 Prozent der Gemeinden die Segnung eingeführt haben. Hanßmann warb dafür, dabei zu bleiben und auf die Basis zu hören.
In einem Zwischenruf sagte Ines Göbbel, die 25 Prozent seien schwer zu erreichen angesichts der vielen Hürden, die das Gesetz vorsehe. Zudem bleibe auch nach dem aktuellen Entwurf die Entscheidung bei den Gemeinden und die 25-Prozent-Regel bleibe unangetastet.
Yasna Crüsemann (Geislingen) sagte, der Entwurf sei für beide Seiten eine Zumutung, man müsse aber die Unterschiedlichkeit der Positionen aushalten. Sie stellte fest, die Kirche habe Menschen “schwer gekränkt, ihnen den Segen verweigert”, sei an ihnen schuldig geworden. Sie fragte: “Wer sind wir, dass wir Menschen den Segen verweigern, die sich lieben und füreinander sorgen wollen?”
Prof. Dr. Martin Plümicke stellte fest, der Gesetzentwurf sei dem Gesprächskreis Lebendige Gemeinde weit entgegengekommen. Der eigentlich entscheidende Unterschied zwischen der bestehenden Regelung und dem neuen Entwurf sei der Begriff der Trauung. Der Titel “Segnung aus Anlass der Eheschließung” sei entwürdigend. Dass es zwei Eheverständnisse gebe, spiegele sich darin, dass der Entwurf nun zwei Bücher innerhalb der einen Trauordnung enthalte.
Thorsten Volz (Backnang) warb dafür, auf die Menschlichkeit Jesus Christi zu hören. Das sei die Botschaft, um die es gehe. Kirche solle nicht “ins Schlafzimmer hineinregieren”.
Prof. Dr. Martina Klärle (Weikersheim) berichtete von persönlichen Erfahrungen. Es gebe viele Wege, Mensch zu sein: “Geschlecht und Liebe kennen keine starren Grenzen.” Gott habe die Menschen geschaffen, wie sie seien. Sie fragte: “Wollen wir an alten Grenzen festhalten, die nicht mehr der Lebenswirklichkeit entsprechen? Wir können die Welt lebensfreundlicher und menschlicher machen. Gott ist größer als jede Schublade.”
Hellger Koepff (Biberach) beklagte, Kompromisse gerieten in der Gesellschaft immer mehr in Verruf, es gebe nur noch Hopp oder Topp. Dabei sei der Kompromiss oft klüger und akzeptabler als die Einzelposition. Hier gehe es nicht um das Bekenntnis, das in Jesus Christus liege. Es gehe um Auslegungen, und die Auslegung sei für den Menschen da und nicht der Mensch für die Auslegung.
Philipp Jägle (Ravensburg) betonte, der Entwurf sei Ergebnis eines anspruchsvollen Weges, der die Kirche weiterbringe. Er schaffe Raum für alle, ohne dass sich jemand aufgeben müsse. Diese Spannung zusammen zu tragen, sei Ausdruck geistlicher Reife. Wandel und Treue stärkten sich hier gegenseitig.
Johannes Söhner (Herrenberg) erinnerte an die Kirchenmitgliedschafts-Untersuchung (KMU 6), die ergeben habe, dass 86 Prozent der deutschen evangelischen Christen die Trauung für alle befürworten und nur 6 Prozent sie ablehnen.
Eckart Schultz-Berg (Stuttgart) sagte, die jetzige Regelung sei umständlich und für viele Menschen unverständlich. Der aktuelle Entwurf gehe ihm zwar nicht weit genug, er werde aber über seinen Schatten springen und zustimmen.
In einem Zwischenruf wiederholt Matthias Hanßmann, schon das 2019er Gesetz sei ein Kompromiss.
Matthias Vosseler (Stuttgart) warb für Zustimmung zum Antrag unter Bezug auf das biblische Wort von Jesus als Weg. Jesu Weg sei aber keine gerade Linie, sondern einer, “auf dem man unterschiedliche Meinungen haben kann mit Jesus in der Mitte”. Auch mit unterschiedlichen Positionen könne man in der Nachfolge Jesus zusammen sein – das festzuhalten sei der Kern des vorliegenden Entwurfs. Zudem traue er den Gemeinden theologische Kompetenz zu.
Annette Sawade (Schwäbisch Hall) sagte, sie wünsche sich, dass die Synodalen bei der Abstimmung nur ihrem Gewissen folgen.
Steffen Kern (Walddorfhäslach) sagte, es gehe in dieser Frage um Persönlichstes, um das Hören auf Gottes Wort, um Gewissensbindung. Dem trage der Entwurf Rechnung. Der Weg dorthin sei ein guter Verständigungsprozess gewesen. Keinen Konsens habe es jedoch beim Begriff der Trauung gegeben. Der Theologische Ausschuss habe gegen seine Verwendung gestimmt. Nun hielten ihn manche für unverzichtbar, um die Gleichheit zu betonen – andere wollten ihn nicht nutzen, gerade um die Ungleichheit zu zeigen. Kern warb dafür, “den Weg der Verständigung zu gehen”.
Dr. Antje Fetzer-Kapolnek (Weinstadt-Beutelsbach) warb für das Gesetz, auch wenn es ihr nicht weit genug gehe. Dass mehr als 75 Prozent der Gemeinden die Segnung noch nicht eingeführt haben, sei kein Argument dagegen, denn es sei zu kompliziert, und die Corona-Zeit habe hier viel verzögert.
Gerhard Keitel (Maulbronn) erinnerte an Jesu Liebesgebot in Joh 13. Liebe heiße, aufeinander zuzugehen. Seiner Meinung nach müsse sich der Gesprächskreis Lebendige Gemeinde bei diesem Gesetz nicht verbiegen. Zur Einheit gehöre dazu, zu ertragen, was andere tun, auch wenn es nicht die eigene Richtung sei.
Oberkirchenrat Dr. Michael Frisch, Leiter des Recht-Dezernats, antwortete auf Fragen von Matthias Hanßmann:
- Segnungen aus Anlass der Eheschließung würden aktuell in ein separates Register innerhalb des Kirchenregisters eingetragen, aber nicht ins Trauregister.
- Das reformatorische Eheverständnis sehe die Trauung als Gottesdienst nach der bürgerlichen Eheschließung vor. Jede kirchliche Trauung sei ein Gottesdienst anlässlich der bürgerlichen Trauung.
- Im Grunde seien “Trauung” und “Gottesdienst anlässlich der Eheschließung” Synonyme.
- Bei der Wahl des Begriffs gehe es um die Frage, ob man eher das Gemeinsame oder eher das Unterscheidende betonen wolle.
- Das Entscheidende sei bei diesem Entwurf die Verfahrensvereinfachung, die Umstellung, dass die Möglichkeit der Segnung auch bei Gemeindefusionen ohne neuerlichen Genehmigungsprozess erhalten bleibe, und Differenzierungen darzustellen, die sich durch die Verwendung der Synonyme nicht ausdrücken lassen.
In einem Zwischenruf fragte Burkhard Frauer (Ditzingen) an Dr. Frisch gerichtet, was passiere, wenn nach der aktuell gültigen Regelung die 25-Prozent-Marke der Gemeinden mit Segnung erreicht sei.
Frisch antwortete, dann müsse sich die Landessynode mit der Frage nach einer einheitlichen landeskirchlichen Trauagende befassen.
Den vollständigen Bericht zu TOP 06 finden Sie in der Klappbox oben: Dokumente zu Tagesordnungspunkt 06
Alle Themen der Tagung
⬆️ Zum Seitenanfang
✳️Landessynode kompakt: Die wichtigsten Themen im Überblick
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente:
- Grußworte
- Verabschiedung der Unabhängigen Kommission zur Gewährung von Leistungen in Anerkennung des Leids Betroffener sexualisierter Gewalt und Verleihung der Silbernen Brenz-Medaille an den Vorsitzenden Wolfgang Vögele
- TOP 01 Strategische Planung
- TOP 02 Planüberschreitungen und Jahresabschluss der landeskirchlichen Rechnung 2024
TOP 03 1. Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 mit Kirchlichem Gesetz - TOP 04 Trauung gleichgeschlechtlich liebender Ehepaare
- TOP 05
- TOP 06 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung und des Gottesdienstes anlässlich der Eheschließung (Beilage 145)
- TOP 07 Kirchliches Gesetz zur Ablösung des Diakonen- und Diakoninnengesetzes und zur Änderung des Württ. Pfarrergesetzes (Beilage 141)
- TOP 08 Kirchliches Gesetz zur Änderung von Dienstverpflichtungen (Beilage 140)
- TOP 09 Gottesdienstbuch für die Ev. Landeskirche in Württemberg, Zweiter Teil, Teilband Einführungen und Verabschiedungen
- TOP 10 Bericht über die Situation der verfolgten Christen in der Welt sowie der Menschen, die aus religiösen, rassistischen, politischen, ethnischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gründen unter Verfolgung leiden – Schwerpunkt auf Syrien, Kolumbien, Nigeria und Pakistan
- TOP 11 Berichte des Beauftragten für die Entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs und des Islambeauftragten
- TOP 12 Aktuelle Stunde
- TOP 13 Schlussbericht des Ausschusses für Mission, Ökumene und Entwicklung
- TOP 14 Schlussbericht des Finanzausschusses
- TOP 15 Schlussbericht des Ausschusses für Bildung und Jugend
- TOP 16 Änderung des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes
- TOP 17 Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 18 Bericht der Projektstelle für die Themen Rassismus und Antisemitismus/Populismus und Extremismus
- Bildergalerie:Impressionen der Herbsttagung
- TOP 19 Abschaffung der Aktuellen Stunde
- TOP 20 OIKOS und die AKSB
- TOP 21 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (Beilage 142)
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (144)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Kirchengemeindeordnung und weiterer Regelungen (Beilage 143)
- TOP 24 Schlussbericht des Rechtsausschusses
- TOP 25 Selbständige Anträge
- TOP 26 Förmliche Anfragen
- TOP 27 Schlussbericht des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung
- TOP 28 Schlussbericht des Theologischen Ausschusses
- TOP 29 Abschlussbericht des Projekts „Geistlich Leiten, vom Geist geleitet“
- TOP 30 Schlussbericht des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung
- TOP 31 „Raum geben“ - Zwischenbericht zu den Projekten „Aufbruch Quartier“ und „Aufbruch Wohnen“
- TOP 32 Abschlussbericht des Projekts „Zukunftsgutscheine”
- TOP 33 Zwischenbericht zum Fonds „#miteinander“
- TOP 34 Schlussbericht des Ausschusses für Diakonie
- TOP 35 Schlussbericht des Sonderausschusses für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte
- TOP 36 Abschluss der 16. Landessynode
- Gottesdienst mit Abendmahl in der Stiftskirche
Dokumente zu Tagesordnungspunkt 06
Beschluss
Das Kirchliche Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung und des Gottesdienstes anlässlich der Eheschließung (Beilage 145) wurde in erster Lesung verabschiedet.
In zweiter Lesung am 24. Oktober erreichte der Gesetzentwurf die notwendige Zweidrittelmehrheit nicht. Er wurde bei 89 abgegebenen Stimmen mit 56 Ja-Stimmen, 31 Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen abgelehnt.
Den vollständigen Bericht zu TOP 06 finden Sie in der Klappbox oben: Dokumente zu Tagesordnungspunkt 06
Hier werden externe Inhalte des (Dritt-)Anbieters ‘Meta Platforms - Instagram’ (Zweck: Soziale Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit) bereitgestellt. Mit Aktivierung des Dienstes stimmen Sie der in unserer Datenschutzinformation und in unserem Consent-Tool beschriebenen Datenverarbeitung zu.
Beitrag auf Instagram
Hier werden externe Inhalte des (Dritt-)Anbieters ‘Facebook’ (Zweck: Soziale Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit) bereitgestellt. Mit Aktivierung des Dienstes stimmen Sie der in unserer Datenschutzinformation und in unserem Consent-Tool beschriebenen Datenverarbeitung zu.
Beitrag auf Facebook
TOP 07 Kirchliches Gesetz zur Ablösung des Diakonen- und Diakoninnengesetzes und zur Änderung des Württ. Pfarrergesetzes (Beilage 141)
Alle Themen der Tagung
⬆️ Zum Seitenanfang
✳️Landessynode kompakt: Die wichtigsten Themen im Überblick
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente:
- Grußworte
- Verabschiedung der Unabhängigen Kommission zur Gewährung von Leistungen in Anerkennung des Leids Betroffener sexualisierter Gewalt und Verleihung der Silbernen Brenz-Medaille an den Vorsitzenden Wolfgang Vögele
- TOP 01 Strategische Planung
- TOP 02 Planüberschreitungen und Jahresabschluss der landeskirchlichen Rechnung 2024
TOP 03 1. Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 mit Kirchlichem Gesetz - TOP 04 Trauung gleichgeschlechtlich liebender Ehepaare
- TOP 05
- TOP 06 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung und des Gottesdienstes anlässlich der Eheschließung (Beilage 145)
- TOP 07 Kirchliches Gesetz zur Ablösung des Diakonen- und Diakoninnengesetzes und zur Änderung des Württ. Pfarrergesetzes (Beilage 141)
- TOP 08 Kirchliches Gesetz zur Änderung von Dienstverpflichtungen (Beilage 140)
- TOP 09 Gottesdienstbuch für die Ev. Landeskirche in Württemberg, Zweiter Teil, Teilband Einführungen und Verabschiedungen
- TOP 10 Bericht über die Situation der verfolgten Christen in der Welt sowie der Menschen, die aus religiösen, rassistischen, politischen, ethnischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gründen unter Verfolgung leiden – Schwerpunkt auf Syrien, Kolumbien, Nigeria und Pakistan
- TOP 11 Berichte des Beauftragten für die Entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs und des Islambeauftragten
- TOP 12 Aktuelle Stunde
- TOP 13 Schlussbericht des Ausschusses für Mission, Ökumene und Entwicklung
- TOP 14 Schlussbericht des Finanzausschusses
- TOP 15 Schlussbericht des Ausschusses für Bildung und Jugend
- TOP 16 Änderung des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes
- TOP 17 Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 18 Bericht der Projektstelle für die Themen Rassismus und Antisemitismus/Populismus und Extremismus
- Bildergalerie:Impressionen der Herbsttagung
- TOP 19 Abschaffung der Aktuellen Stunde
- TOP 20 OIKOS und die AKSB
- TOP 21 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (Beilage 142)
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (144)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Kirchengemeindeordnung und weiterer Regelungen (Beilage 143)
- TOP 24 Schlussbericht des Rechtsausschusses
- TOP 25 Selbständige Anträge
- TOP 26 Förmliche Anfragen
- TOP 27 Schlussbericht des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung
- TOP 28 Schlussbericht des Theologischen Ausschusses
- TOP 29 Abschlussbericht des Projekts „Geistlich Leiten, vom Geist geleitet“
- TOP 30 Schlussbericht des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung
- TOP 31 „Raum geben“ - Zwischenbericht zu den Projekten „Aufbruch Quartier“ und „Aufbruch Wohnen“
- TOP 32 Abschlussbericht des Projekts „Zukunftsgutscheine”
- TOP 33 Zwischenbericht zum Fonds „#miteinander“
- TOP 34 Schlussbericht des Ausschusses für Diakonie
- TOP 35 Schlussbericht des Sonderausschusses für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte
- TOP 36 Abschluss der 16. Landessynode
- Gottesdienst mit Abendmahl in der Stiftskirche
Dokumente zu Tagesordnungspunkt 07
Neues Diakoninnen- und Diakonegesetz und Änderungen am Pfarrergesetz beschlossen

Die Landessynode hat auf ihrer Herbsttagung der Beilage 141 zugestimmt. Damit tritt das Diakonen- und Diakoninnengesetz zum 1. Januar 2026 außer Kraft und wird durch das neue Kirchliches Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Diakoninnen und Diakone in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg abgelöst.
Professor Dr. Martin Plümicke, stellvertretender Vorsitzender des Rechtsausschusses, informierte die Synodalen über die mit großer Mehrheit beschlossene Zustimmung des Rechtsausschusses zur Beilage 141. Der Gesetzentwurf sah vor, zunächst einige Formulierungen im Diakonen- und Diakoninnengesetz zu ändern. Auch im Pfarrergesetz sollten daher betreffende Formulierungen angepasst werden. Plümicke stellte auf der Herbsttagung detailliert dar, welche Stellen in den beiden Gesetzen hierfür konkret geändert werden sollten.
Aussprache
Jörg Beurer (Heilbronn) bedankte sich im Namen des Diakonieausschusses für die Beratungen und Vorarbeiten. Er freue sich, wenn das Gesetz mit einer Änderung beschlossen werden könnte. Er bat um Nachsicht, dass er diesen Änderungsantrag so kurzfristig einreiche. Die Änderungen seien erst bei einer letzten genauen Durchsicht aufgefallen. Anschließend erläuterte er im Einzelnen, was die Änderungen bedeuteten. Beurer begrüßte, dass der Oberkirchenrat parallel dabei sei, bestehende Hürden und den formalen Aufwand, der mit der Beauftragung von Diakoninnen und Diakonen verbunden sei, mit Hilfe eines erneuerten Rundschreibens abzubauen. Das liege auf einer Linie mit der Intention des Antrags.
Angelika Klingel (Heimsheim) freute sich über die mit Gästen aus dem Diakonat besetzen Zuschauerränge. Sie bedankte sich bei allen, die an der Überarbeitung des Gesetzes mitgewirkt hatten und meinte: „Was lange währt, wird endlich gut“. Es herrsche große Zustimmung zu den notwendigen Inhalten des Gesetzes, das auch wichtige Punkte aus Stellungnahmen von Verbänden und Gemeinschaften enthält. Klingel unterstrich dabei die herausragende Bedeutung von Diakonie, die „gelebter Glaube der christlichen Gemeinde in Wort und Tat“ sei, und bezeichnete die Diakoninnen und Diakone als „Schatz der Kirche“, die Brücken zu Menschen bauen, die „Glaubensstärkung, Unterstützung, Bildung, Pflege, Fürsorge und Beistand brauchen“. Es brauche daher konkrete Zusagen der Kirche als Dach und Arbeitgeberin, die sie für die Diakoninnen und Diakone im Land attraktiv macht.
Der Synodale Siegfried Jahn (Schrozberg) meinte, dass ihn die Neuordnung der verschiedenen Dienste angesprochen hätten, da dies zeige, dass die Landeskirche wegkomme von einem hierarchischen Denken, von Pfarramt und Diakonat. Es gehe nicht mehr um das Pfarramt, sondern um den Pfarrdienst, der um das Diakonat ergänzt wird. Der Pfarrdienst sei für das Wort, für die Verkündigung zuständig. Jahn erinnerte daran, „auch tun zu müssen, was wir wissen“. Dazu sei das Diakonat mit einem hohen Wissensstand nötig, das genau durch eine solch qualifizierte Ausbildung gewährleistet sei. So sei die Landeskirche multiprofessioneller als in der Vergangenheit aufgestellt. Im Pfarrdienst müsse aus seiner Sicht die Multiprofessionalität im Vikariat mitbedacht werden, da beide Dienste notwendig seien und gut profiliert gebraucht würden.
Andrea Bleher (Untermünkheim) bedankte sich für das Gesetz, in dem vieles ergänzt und präzisiert worden sei, was sie begrüße. Sie unterstütze voll und ganz die beiden von Jörg Beurer eingebrachten Änderungen und warb abschließend um Zustimmung zum Gesetz.
Götz Kanzleiter (Ostelsheim) stellte zu Beginn seiner Wortmeldung die Frage in den Raum, wie es gelänge, junge Menschen für den kirchlichen Dienst zu gewinnen, und reflektierte dabei seinen eigenen Werdegang. Aus eigener Erfahrung erinnerte er daran, dass Diakoninnen und Diakone immer wieder auch in prekäre Anstellungsverhältnisse rutschen, zum Beispiel wenn sie eine Projektstelle übernehmen. Allerdings baue man so eine spezielle und auch freiheitliche Beziehung zur Landeskirche auf, was angesichts der guten Ausbildungszahlen im Diakonat offenbar auch Anklang bei jungen Menschen finde. Daher halte er das Modell des Diakonats für spannend und wichtig. Die Aufgabe, in welcher Form junge Menschen in Freiheit an die Landeskirche gebunden werden können, gab er an die kommende Landessynode weiter.
Beschluss
Die Herbstsynode hat den Änderungsantrag Nr. 30/25 in erster Lesung verabschiedet.
Der Gesetzentwurf zur Ablösung des Diakonen- und Diakoninnengesetzes und zur Änderung des württembergischen Pfarrergesetzes (Beilage 141) wurde in zweiter Lesung einstimmig angenommen.
Den vollständigen Bericht zu TOP 07 finden Sie in der Klappbox oben: Dokumente zu Tagesordnungspunkt 07
TOP 08 Kirchliches Gesetz zur Änderung von Dienstverpflichtungen (Beilage 140)
Alle Themen der Tagung
⬆️ Zum Seitenanfang
✳️Landessynode kompakt: Die wichtigsten Themen im Überblick
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente:
- Grußworte
- Verabschiedung der Unabhängigen Kommission zur Gewährung von Leistungen in Anerkennung des Leids Betroffener sexualisierter Gewalt und Verleihung der Silbernen Brenz-Medaille an den Vorsitzenden Wolfgang Vögele
- TOP 01 Strategische Planung
- TOP 02 Planüberschreitungen und Jahresabschluss der landeskirchlichen Rechnung 2024
TOP 03 1. Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 mit Kirchlichem Gesetz - TOP 04 Trauung gleichgeschlechtlich liebender Ehepaare
- TOP 05
- TOP 06 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung und des Gottesdienstes anlässlich der Eheschließung (Beilage 145)
- TOP 07 Kirchliches Gesetz zur Ablösung des Diakonen- und Diakoninnengesetzes und zur Änderung des Württ. Pfarrergesetzes (Beilage 141)
- TOP 08 Kirchliches Gesetz zur Änderung von Dienstverpflichtungen (Beilage 140)
- TOP 09 Gottesdienstbuch für die Ev. Landeskirche in Württemberg, Zweiter Teil, Teilband Einführungen und Verabschiedungen
- TOP 10 Bericht über die Situation der verfolgten Christen in der Welt sowie der Menschen, die aus religiösen, rassistischen, politischen, ethnischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gründen unter Verfolgung leiden – Schwerpunkt auf Syrien, Kolumbien, Nigeria und Pakistan
- TOP 11 Berichte des Beauftragten für die Entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs und des Islambeauftragten
- TOP 12 Aktuelle Stunde
- TOP 13 Schlussbericht des Ausschusses für Mission, Ökumene und Entwicklung
- TOP 14 Schlussbericht des Finanzausschusses
- TOP 15 Schlussbericht des Ausschusses für Bildung und Jugend
- TOP 16 Änderung des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes
- TOP 17 Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 18 Bericht der Projektstelle für die Themen Rassismus und Antisemitismus/Populismus und Extremismus
- Bildergalerie:Impressionen der Herbsttagung
- TOP 19 Abschaffung der Aktuellen Stunde
- TOP 20 OIKOS und die AKSB
- TOP 21 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (Beilage 142)
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (144)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Kirchengemeindeordnung und weiterer Regelungen (Beilage 143)
- TOP 24 Schlussbericht des Rechtsausschusses
- TOP 25 Selbständige Anträge
- TOP 26 Förmliche Anfragen
- TOP 27 Schlussbericht des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung
- TOP 28 Schlussbericht des Theologischen Ausschusses
- TOP 29 Abschlussbericht des Projekts „Geistlich Leiten, vom Geist geleitet“
- TOP 30 Schlussbericht des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung
- TOP 31 „Raum geben“ - Zwischenbericht zu den Projekten „Aufbruch Quartier“ und „Aufbruch Wohnen“
- TOP 32 Abschlussbericht des Projekts „Zukunftsgutscheine”
- TOP 33 Zwischenbericht zum Fonds „#miteinander“
- TOP 34 Schlussbericht des Ausschusses für Diakonie
- TOP 35 Schlussbericht des Sonderausschusses für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte
- TOP 36 Abschluss der 16. Landessynode
- Gottesdienst mit Abendmahl in der Stiftskirche
Dokumente zu Tagesordnungspunkt 08
Überarbeitung des Wortlauts der Dienstverpflichtungen

Die neuen Formulierungen dienen der Anpassung an Veränderungen im Kirchen- und Amtsverständnis sowie an veränderte Sprachgewohnheiten. Das Gesetz wurde in zweiter Lesung verabschiedet.
Prof. Dr. Martin Plümicke, Vorsitzender des Rechtsausschusses, stellte die Veränderungen an der Dienstverpflichtung vor. Nach einer ersten Vorlage im Rahmen der Herbstsynode 2024 hätten sich der Oberkirchenrat und der Theologische Ausschuss nochmals mit dem Thema befasst. Eine Stellungnahme des Theologischen Ausschusses habe dann als Grundlage für die Änderungen gedient, die der Oberkirchenrat vorgelegt habe.
Unter anderem würde nun die Mitarbeit des Menschen an der Kirche Gottes deutlicher. Der abschließende Satz betone den Dienst an Gott und Menschen verständlicher und wäre nicht mehr nur Teil der Dienstverpflichtung des Pfarrdienstes, sondern aller kirchlichen Ämter.
Der Rechtsausschuss habe diesen Veränderungen am kirchlichen Gesetz zur Änderung der Dienstverpflichtungen zugestimmt und empfehle damit der Synode die Annahme.
Aussprache
Michael Klein (Plochingen) brachte den Änderungsantrag 31/25 ein. Er begründete dies mit drei Punkten, die unklar formuliert wären. So fehle ihm die Klarheit, dass der Gehorsam Jesus Christus und erst dann der Ordnung der Landeskirche gilt. Ebenso die „Formulierung von Verkündigung, Lehre und Leben“ in Bezug auf den Bau der Kirche. Die Formulierung „was dem Evangelium widerspricht“ würde durch „falscher Lehre und der Unordnung in der Kirche“ präziser.
Michael Schneider (Balingen) sagte, er habe die derzeitig gültige Version, die Version des Theologischen Ausschusses und den Änderungsantrag verglichen. Dabei sähe er zwar sprachliche, aber keine inhaltlichen Unterschiede und zweifle die Notwendigkeit einer Änderung der aktuellen Fassung an.
Dr. Antje Fetzer-Kapolnek (Weinstadt-Beutelsbach) merkte an, dass beim Gelübde der Landessynodalen die Formulierung „in meinem Teil dazu beitragen“ nicht angeglichen wurde. Diese fände sie schöner, weil der eigene Anteil an der Gesamtverantwortung klar würde.
Hellger Koepff (Biberach) berichtete aus dem Theologischen Ausschuss. Dieser habe sich im letzten Jahr intensiv mit allen Rückfragen beschäftigt. Dabei wären auch die Überlegungen des Änderungsantrags bereits zur Sprache gekommen. Dabei seien sie „sowohl sprachlich, aber auch theologisch bei der Formulierung geblieben“. Die vorliegende Fassung sei gleichzeitig theologisch konzentriert und gut verständlich.
Michael Schneider (Balingen) bedankte sich in einem Zwischenruf für die Erklärungen. Er würde jedoch beide Begriffe trotzdem gleichwertig wahrnehmen.
Koepff antwortete darauf, dass mit der Formulierung „Falsche Lehre“ etwas anderes assoziiert würde und dieser von Menschen verwendet werde, die selbst dem Evangelium widersprächen.
Rainer Köpf (Backnang) wies darauf hin, dass sich auch der Liturgieausschuss gründlich und transparent mit dem Thema befasst hätte. Er möge die alten Formulierungen selbst gerne, jedoch hätte sich die Sprache entwickelt und manches wäre nur noch schwer verständlich. Inhaltlich stimme die neue Fassung mit der alten aber überein.
Mit einem Zwischenruf betonte Michael Klein (Plochingen), dass es ihm nicht um den Erhalt alter Formulierungen ginge, sondern um deren inhaltliches Gewicht. Den vorliegenden Entwurf fände er hier nicht ausgereift.
Prof. Dr. J. Thomas Hörnig (Ludwigsburg) stellte anhand einer kurzen Anekdote dar, dass auch die aktuelle Formulierung Auslegung benötige. So sei nicht klar, wie viel Souveränität in der Nachfolge beansprucht werden könne und wie viel das Kirchenrecht vorgäbe. Auch er möge die alten Texte, stimme aber der Neufassung des Ausschusses zu.
Es hat eine Beratung des Rechtsausschusses im Beisein des Antragstellers Klein und des Vorsitzenden des Theologischen Ausschusses über den Änderungsantrag 31/25 stattgefunden.
Prof. Dr. Martin Plümicke (Reutlingen) berichtete über die Sitzung des Rechtsausschusses. Koepff habe bereits viele Punkte angesprochen, die er nicht wiederholen wolle. Der Antrag spräche zudem noch vom „pfarramtlichen Dienst“, worauf in Bezug auf das Diakonen- und Diakoninnengesetz bewusst verzichtet wurde. Der Rechtsausschuss habe den Antrag mit deutlicher Mehrheit abgelehnt.
Oberkirchenrat Dr. Michael Frisch (Dezernat Recht) äußerte sich nicht inhaltlich zum Antrag. Er betonte jedoch, dass eine Änderung am Gesetzesentwurf in diesem Fall dazu führen würde, dass auch die Agende geändert werden müsse. Hierüber entschiede aber nicht die Synode, sondern der Oberkirchenrat und der Theologische Ausschuss. Die Beratungen über sowohl dieses Gesetz als auch über die Agende wären dann im Rahmen dieser Synode nicht mehr möglich.
Beschluss
Der Änderungsantrag 31/25 wurde mit 9 Stimmen für den Antrag und 19 Enthaltungen abgelehnt.
Das kirchliche Gesetz zur Änderung von Dienstverpflichtungen erhielt in zweiter Lesung, bei 4 Gegenstimmen und einer Enthaltung, die nötige qualifizierte Mehrheit.
Den vollständigen Bericht zu TOP 08 finden Sie in der Klappbox oben: Dokumente zu Tagesordnungspunkt 08
TOP 09 Gottesdienstbuch für die Ev. Landeskirche in Württemberg, Zweiter Teil, Teilband Einführungen und Verabschiedungen
Alle Themen der Tagung
⬆️ Zum Seitenanfang
✳️Landessynode kompakt: Die wichtigsten Themen im Überblick
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente:
- Grußworte
- Verabschiedung der Unabhängigen Kommission zur Gewährung von Leistungen in Anerkennung des Leids Betroffener sexualisierter Gewalt und Verleihung der Silbernen Brenz-Medaille an den Vorsitzenden Wolfgang Vögele
- TOP 01 Strategische Planung
- TOP 02 Planüberschreitungen und Jahresabschluss der landeskirchlichen Rechnung 2024
TOP 03 1. Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 mit Kirchlichem Gesetz - TOP 04 Trauung gleichgeschlechtlich liebender Ehepaare
- TOP 05
- TOP 06 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung und des Gottesdienstes anlässlich der Eheschließung (Beilage 145)
- TOP 07 Kirchliches Gesetz zur Ablösung des Diakonen- und Diakoninnengesetzes und zur Änderung des Württ. Pfarrergesetzes (Beilage 141)
- TOP 08 Kirchliches Gesetz zur Änderung von Dienstverpflichtungen (Beilage 140)
- TOP 09 Gottesdienstbuch für die Ev. Landeskirche in Württemberg, Zweiter Teil, Teilband Einführungen und Verabschiedungen
- TOP 10 Bericht über die Situation der verfolgten Christen in der Welt sowie der Menschen, die aus religiösen, rassistischen, politischen, ethnischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gründen unter Verfolgung leiden – Schwerpunkt auf Syrien, Kolumbien, Nigeria und Pakistan
- TOP 11 Berichte des Beauftragten für die Entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs und des Islambeauftragten
- TOP 12 Aktuelle Stunde
- TOP 13 Schlussbericht des Ausschusses für Mission, Ökumene und Entwicklung
- TOP 14 Schlussbericht des Finanzausschusses
- TOP 15 Schlussbericht des Ausschusses für Bildung und Jugend
- TOP 16 Änderung des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes
- TOP 17 Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 18 Bericht der Projektstelle für die Themen Rassismus und Antisemitismus/Populismus und Extremismus
- Bildergalerie:Impressionen der Herbsttagung
- TOP 19 Abschaffung der Aktuellen Stunde
- TOP 20 OIKOS und die AKSB
- TOP 21 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (Beilage 142)
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (144)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Kirchengemeindeordnung und weiterer Regelungen (Beilage 143)
- TOP 24 Schlussbericht des Rechtsausschusses
- TOP 25 Selbständige Anträge
- TOP 26 Förmliche Anfragen
- TOP 27 Schlussbericht des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung
- TOP 28 Schlussbericht des Theologischen Ausschusses
- TOP 29 Abschlussbericht des Projekts „Geistlich Leiten, vom Geist geleitet“
- TOP 30 Schlussbericht des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung
- TOP 31 „Raum geben“ - Zwischenbericht zu den Projekten „Aufbruch Quartier“ und „Aufbruch Wohnen“
- TOP 32 Abschlussbericht des Projekts „Zukunftsgutscheine”
- TOP 33 Zwischenbericht zum Fonds „#miteinander“
- TOP 34 Schlussbericht des Ausschusses für Diakonie
- TOP 35 Schlussbericht des Sonderausschusses für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte
- TOP 36 Abschluss der 16. Landessynode
- Gottesdienst mit Abendmahl in der Stiftskirche
Dokumente zu Tagesordnungspunkt 09
Alle Themen der Tagung
⬆️ Zum Seitenanfang
✳️Landessynode kompakt: Die wichtigsten Themen im Überblick
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente:
- Grußworte
- Verabschiedung der Unabhängigen Kommission zur Gewährung von Leistungen in Anerkennung des Leids Betroffener sexualisierter Gewalt und Verleihung der Silbernen Brenz-Medaille an den Vorsitzenden Wolfgang Vögele
- TOP 01 Strategische Planung
- TOP 02 Planüberschreitungen und Jahresabschluss der landeskirchlichen Rechnung 2024
TOP 03 1. Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 mit Kirchlichem Gesetz - TOP 04 Trauung gleichgeschlechtlich liebender Ehepaare
- TOP 05
- TOP 06 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung und des Gottesdienstes anlässlich der Eheschließung (Beilage 145)
- TOP 07 Kirchliches Gesetz zur Ablösung des Diakonen- und Diakoninnengesetzes und zur Änderung des Württ. Pfarrergesetzes (Beilage 141)
- TOP 08 Kirchliches Gesetz zur Änderung von Dienstverpflichtungen (Beilage 140)
- TOP 09 Gottesdienstbuch für die Ev. Landeskirche in Württemberg, Zweiter Teil, Teilband Einführungen und Verabschiedungen
- TOP 10 Bericht über die Situation der verfolgten Christen in der Welt sowie der Menschen, die aus religiösen, rassistischen, politischen, ethnischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gründen unter Verfolgung leiden – Schwerpunkt auf Syrien, Kolumbien, Nigeria und Pakistan
- TOP 11 Berichte des Beauftragten für die Entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs und des Islambeauftragten
- TOP 12 Aktuelle Stunde
- TOP 13 Schlussbericht des Ausschusses für Mission, Ökumene und Entwicklung
- TOP 14 Schlussbericht des Finanzausschusses
- TOP 15 Schlussbericht des Ausschusses für Bildung und Jugend
- TOP 16 Änderung des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes
- TOP 17 Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 18 Bericht der Projektstelle für die Themen Rassismus und Antisemitismus/Populismus und Extremismus
- Bildergalerie:Impressionen der Herbsttagung
- TOP 19 Abschaffung der Aktuellen Stunde
- TOP 20 OIKOS und die AKSB
- TOP 21 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (Beilage 142)
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (144)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Kirchengemeindeordnung und weiterer Regelungen (Beilage 143)
- TOP 24 Schlussbericht des Rechtsausschusses
- TOP 25 Selbständige Anträge
- TOP 26 Förmliche Anfragen
- TOP 27 Schlussbericht des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung
- TOP 28 Schlussbericht des Theologischen Ausschusses
- TOP 29 Abschlussbericht des Projekts „Geistlich Leiten, vom Geist geleitet“
- TOP 30 Schlussbericht des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung
- TOP 31 „Raum geben“ - Zwischenbericht zu den Projekten „Aufbruch Quartier“ und „Aufbruch Wohnen“
- TOP 32 Abschlussbericht des Projekts „Zukunftsgutscheine”
- TOP 33 Zwischenbericht zum Fonds „#miteinander“
- TOP 34 Schlussbericht des Ausschusses für Diakonie
- TOP 35 Schlussbericht des Sonderausschusses für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte
- TOP 36 Abschluss der 16. Landessynode
- Gottesdienst mit Abendmahl in der Stiftskirche
Dokumente zu Tagesordnungspunkt 09
Bericht des Theologischen Ausschusses

Hellger Koepff, der Vorsitzende des Theologischen Ausschusses, berichtet vom Fortgang der Diskussionen um die neue Einführungsagende, die der Oberkirchenrat bei der Herbsttagung 2024 im Antrag 33/24 der Synode vorgelegt habe. Nach einer Vielzahl von teils fundamentalen Einwänden und intensiven Diskussionen stehe nun ein überarbeiteter Entwurf zum Beschluss (Folgeantrag 27/25).
Koepff berichtete, es seien nach der Synodaltagung im Herbst 2024 viele Einwände und Anregungen eingegangen, die in und zwischen Theologischem Ausschuss, Liturgischer Kommission und Oberkirchenrat diskutiert worden seien. Inhaltlich werde Oberkirchenrat Dr. Jörg Schneider dies im Anschluss erläutern.
Zwei Grundlagen seien wichtig: Erstens sehe sich die Landeskirche als lutherische Kirche in allen Fragen um Amt und Dienst in den Konsens der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) und auch der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE) und in den dort gefundenen Umgang mit den Bekenntnissen, insbesondere der Confessio Augustana, eingebunden. Zweitens ändere eine neue Agende nicht die Rechtslage, sondern bilde diese ab. Die Rechtslage werde sich „in den nächsten Jahren verändern müssen – ich denke etwa an die Rolle der Ehrenamtlichen oder der Diakoninnen und Diakone.“
Hellger Koepff erklärte im Namen des Theologischen Ausschusses, der alte Antrag 33/24 solle nicht weiterverfolgt werden. Stattdessen stehe der Folgeantrag 32/25 zur Entscheidung, mit dem der neue Entwurf beschlossen werden solle. Diese Neufassung des ursprünglich geplanten Antrags 27/25 nimmt die Änderungen des Diakonen- und Diakoninnengesetzes auf, die zuvor unter TOP 07 mit Änderungsantrag 30/25 beschlossen wurden und sich hier auch auswirken.
Den vollständigen Bericht zu TOP 09 finden Sie in der Klappbox oben: Dokumente zu Tagesordnungspunkt 09
Alle Themen der Tagung
⬆️ Zum Seitenanfang
✳️Landessynode kompakt: Die wichtigsten Themen im Überblick
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente:
- Grußworte
- Verabschiedung der Unabhängigen Kommission zur Gewährung von Leistungen in Anerkennung des Leids Betroffener sexualisierter Gewalt und Verleihung der Silbernen Brenz-Medaille an den Vorsitzenden Wolfgang Vögele
- TOP 01 Strategische Planung
- TOP 02 Planüberschreitungen und Jahresabschluss der landeskirchlichen Rechnung 2024
TOP 03 1. Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 mit Kirchlichem Gesetz - TOP 04 Trauung gleichgeschlechtlich liebender Ehepaare
- TOP 05
- TOP 06 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung und des Gottesdienstes anlässlich der Eheschließung (Beilage 145)
- TOP 07 Kirchliches Gesetz zur Ablösung des Diakonen- und Diakoninnengesetzes und zur Änderung des Württ. Pfarrergesetzes (Beilage 141)
- TOP 08 Kirchliches Gesetz zur Änderung von Dienstverpflichtungen (Beilage 140)
- TOP 09 Gottesdienstbuch für die Ev. Landeskirche in Württemberg, Zweiter Teil, Teilband Einführungen und Verabschiedungen
- TOP 10 Bericht über die Situation der verfolgten Christen in der Welt sowie der Menschen, die aus religiösen, rassistischen, politischen, ethnischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gründen unter Verfolgung leiden – Schwerpunkt auf Syrien, Kolumbien, Nigeria und Pakistan
- TOP 11 Berichte des Beauftragten für die Entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs und des Islambeauftragten
- TOP 12 Aktuelle Stunde
- TOP 13 Schlussbericht des Ausschusses für Mission, Ökumene und Entwicklung
- TOP 14 Schlussbericht des Finanzausschusses
- TOP 15 Schlussbericht des Ausschusses für Bildung und Jugend
- TOP 16 Änderung des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes
- TOP 17 Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 18 Bericht der Projektstelle für die Themen Rassismus und Antisemitismus/Populismus und Extremismus
- Bildergalerie:Impressionen der Herbsttagung
- TOP 19 Abschaffung der Aktuellen Stunde
- TOP 20 OIKOS und die AKSB
- TOP 21 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (Beilage 142)
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (144)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Kirchengemeindeordnung und weiterer Regelungen (Beilage 143)
- TOP 24 Schlussbericht des Rechtsausschusses
- TOP 25 Selbständige Anträge
- TOP 26 Förmliche Anfragen
- TOP 27 Schlussbericht des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung
- TOP 28 Schlussbericht des Theologischen Ausschusses
- TOP 29 Abschlussbericht des Projekts „Geistlich Leiten, vom Geist geleitet“
- TOP 30 Schlussbericht des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung
- TOP 31 „Raum geben“ - Zwischenbericht zu den Projekten „Aufbruch Quartier“ und „Aufbruch Wohnen“
- TOP 32 Abschlussbericht des Projekts „Zukunftsgutscheine”
- TOP 33 Zwischenbericht zum Fonds „#miteinander“
- TOP 34 Schlussbericht des Ausschusses für Diakonie
- TOP 35 Schlussbericht des Sonderausschusses für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte
- TOP 36 Abschluss der 16. Landessynode
- Gottesdienst mit Abendmahl in der Stiftskirche
Dokumente zu Tagesordnungspunkt 09
Bericht des Oberkirchenrats

Oberkirchenrat Dr. Jörg Schneider, Leiter des Dezernats für Theologie, Gemeinde und weltweite Kirche, stellte die Veränderungen gegenüber dem ersten Entwurf der neuen Einführungsagende im Detail dar. Sie finden diese Erläuterungen in seinem schriftlichen Bericht in den Dokumenten zu diesem Tagesordnungspunkt.
Schneider sagte mit Blick auf die vielen Rückmeldungen zum ersten Entwurf, der Oberkirchenrat schätze „diese Form der breiten Beteiligung sehr, weil sie sichtbar macht, dass es bei uns in Württemberg partizipativ zugeht“. Er betonte, der Entwurf der neuen Agende atme „den Geist der Freiheit, den sich die Agierenden nehmen können und auch sollen. Wir gehen davon aus, dass vor Ort gewusst wird bzw. bewusst ist, wie mit agendarischen Vorgaben verantwortungsvoll und zugleich geistvoll-frei umgegangen wird.“
In sechs Punkten sei der Ursprungsentwurf überarbeitet worden: Amtsversprechen, Amtsverständnis, Diakonat, Leitungspersonen in der Arbeit diakonischer Träger, Einführung/Einsetzung und Redaktionelles. Die Details finden Sie im ausführlichen Bericht von Jörg Schneider in den Tagungsdokumenten.
Den vollständigen Bericht zu TOP 09 finden Sie in der Klappbox oben: Dokumente zu Tagesordnungspunkt 09
Alle Themen der Tagung
⬆️ Zum Seitenanfang
✳️Landessynode kompakt: Die wichtigsten Themen im Überblick
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente:
- Grußworte
- Verabschiedung der Unabhängigen Kommission zur Gewährung von Leistungen in Anerkennung des Leids Betroffener sexualisierter Gewalt und Verleihung der Silbernen Brenz-Medaille an den Vorsitzenden Wolfgang Vögele
- TOP 01 Strategische Planung
- TOP 02 Planüberschreitungen und Jahresabschluss der landeskirchlichen Rechnung 2024
TOP 03 1. Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 mit Kirchlichem Gesetz - TOP 04 Trauung gleichgeschlechtlich liebender Ehepaare
- TOP 05
- TOP 06 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung und des Gottesdienstes anlässlich der Eheschließung (Beilage 145)
- TOP 07 Kirchliches Gesetz zur Ablösung des Diakonen- und Diakoninnengesetzes und zur Änderung des Württ. Pfarrergesetzes (Beilage 141)
- TOP 08 Kirchliches Gesetz zur Änderung von Dienstverpflichtungen (Beilage 140)
- TOP 09 Gottesdienstbuch für die Ev. Landeskirche in Württemberg, Zweiter Teil, Teilband Einführungen und Verabschiedungen
- TOP 10 Bericht über die Situation der verfolgten Christen in der Welt sowie der Menschen, die aus religiösen, rassistischen, politischen, ethnischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gründen unter Verfolgung leiden – Schwerpunkt auf Syrien, Kolumbien, Nigeria und Pakistan
- TOP 11 Berichte des Beauftragten für die Entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs und des Islambeauftragten
- TOP 12 Aktuelle Stunde
- TOP 13 Schlussbericht des Ausschusses für Mission, Ökumene und Entwicklung
- TOP 14 Schlussbericht des Finanzausschusses
- TOP 15 Schlussbericht des Ausschusses für Bildung und Jugend
- TOP 16 Änderung des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes
- TOP 17 Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 18 Bericht der Projektstelle für die Themen Rassismus und Antisemitismus/Populismus und Extremismus
- Bildergalerie:Impressionen der Herbsttagung
- TOP 19 Abschaffung der Aktuellen Stunde
- TOP 20 OIKOS und die AKSB
- TOP 21 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (Beilage 142)
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (144)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Kirchengemeindeordnung und weiterer Regelungen (Beilage 143)
- TOP 24 Schlussbericht des Rechtsausschusses
- TOP 25 Selbständige Anträge
- TOP 26 Förmliche Anfragen
- TOP 27 Schlussbericht des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung
- TOP 28 Schlussbericht des Theologischen Ausschusses
- TOP 29 Abschlussbericht des Projekts „Geistlich Leiten, vom Geist geleitet“
- TOP 30 Schlussbericht des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung
- TOP 31 „Raum geben“ - Zwischenbericht zu den Projekten „Aufbruch Quartier“ und „Aufbruch Wohnen“
- TOP 32 Abschlussbericht des Projekts „Zukunftsgutscheine”
- TOP 33 Zwischenbericht zum Fonds „#miteinander“
- TOP 34 Schlussbericht des Ausschusses für Diakonie
- TOP 35 Schlussbericht des Sonderausschusses für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte
- TOP 36 Abschluss der 16. Landessynode
- Gottesdienst mit Abendmahl in der Stiftskirche
Dokumente zu Tagesordnungspunkt 09
Aussprache

Gunter Seibold (Filderstadt) sagte, Liturgie sei etwas Ästhetisches und nicht nur etwas Funktionales. Das Gottesdienstbuch entspreche dem Diskussionsstand. Mit seiner Nein-Stimme wolle er zeigen, dass aus seiner Sicht manches theologisch nicht passe und die Entwicklung in die falsche Richtung laufe. Das neue Gottesdienstbuch enge zu sehr ein, und die Berücksichtigung aller Dienste sei ein “unübersichtliches Schubladensystem”. Er wünsche sich eine Konzentration auf Kernelemente und sonst mehr Freiheiten.
Martin Wurster (Schömberg-Langenbrand) fragte Dr. Jörg Schneider, ob das neue Gottesdienstbuch im Januar bei der Einführung der neuen Kirchengemeinderäte schon verfügbar sein werde.
Dies bejahte Schneider, da es zeitnah eine digitale Ausgabe geben werde.
Amrei Steinfort (Hechingen) dankte dafür, dass die Vokation der Religionslehrerinnen und –lehrer einen prominenten Platz habe. Sie werde es gerne nutzen.
Oberkirchenrat Dr. Jörg Schneider sagte in seiner Antwort, das neue Buch sehe nach viel Papier aus, es sei aber ein Organismus, der viel mehr Freiheiten ermögliche, als es scheine.
Eckart Schultz-Berg sagte, er tue sich schwer mit der Detailliertheit des Buches und die Entpflichtungen seien ihm “zu hoch gehängt”. Aber die Kommission habe sehr sorgfältig gearbeitet. Die Agende müsse in der praktischen Anwendung und Erprobung auch eine gewisse Freiheit haben.
Den vollständigen Bericht zu TOP 09 finden Sie in der Klappbox oben: Dokumente zu Tagesordnungspunkt 09
Alle Themen der Tagung
⬆️ Zum Seitenanfang
✳️Landessynode kompakt: Die wichtigsten Themen im Überblick
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente:
- Grußworte
- Verabschiedung der Unabhängigen Kommission zur Gewährung von Leistungen in Anerkennung des Leids Betroffener sexualisierter Gewalt und Verleihung der Silbernen Brenz-Medaille an den Vorsitzenden Wolfgang Vögele
- TOP 01 Strategische Planung
- TOP 02 Planüberschreitungen und Jahresabschluss der landeskirchlichen Rechnung 2024
TOP 03 1. Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 mit Kirchlichem Gesetz - TOP 04 Trauung gleichgeschlechtlich liebender Ehepaare
- TOP 05
- TOP 06 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung und des Gottesdienstes anlässlich der Eheschließung (Beilage 145)
- TOP 07 Kirchliches Gesetz zur Ablösung des Diakonen- und Diakoninnengesetzes und zur Änderung des Württ. Pfarrergesetzes (Beilage 141)
- TOP 08 Kirchliches Gesetz zur Änderung von Dienstverpflichtungen (Beilage 140)
- TOP 09 Gottesdienstbuch für die Ev. Landeskirche in Württemberg, Zweiter Teil, Teilband Einführungen und Verabschiedungen
- TOP 10 Bericht über die Situation der verfolgten Christen in der Welt sowie der Menschen, die aus religiösen, rassistischen, politischen, ethnischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gründen unter Verfolgung leiden – Schwerpunkt auf Syrien, Kolumbien, Nigeria und Pakistan
- TOP 11 Berichte des Beauftragten für die Entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs und des Islambeauftragten
- TOP 12 Aktuelle Stunde
- TOP 13 Schlussbericht des Ausschusses für Mission, Ökumene und Entwicklung
- TOP 14 Schlussbericht des Finanzausschusses
- TOP 15 Schlussbericht des Ausschusses für Bildung und Jugend
- TOP 16 Änderung des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes
- TOP 17 Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 18 Bericht der Projektstelle für die Themen Rassismus und Antisemitismus/Populismus und Extremismus
- Bildergalerie:Impressionen der Herbsttagung
- TOP 19 Abschaffung der Aktuellen Stunde
- TOP 20 OIKOS und die AKSB
- TOP 21 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (Beilage 142)
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (144)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Kirchengemeindeordnung und weiterer Regelungen (Beilage 143)
- TOP 24 Schlussbericht des Rechtsausschusses
- TOP 25 Selbständige Anträge
- TOP 26 Förmliche Anfragen
- TOP 27 Schlussbericht des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung
- TOP 28 Schlussbericht des Theologischen Ausschusses
- TOP 29 Abschlussbericht des Projekts „Geistlich Leiten, vom Geist geleitet“
- TOP 30 Schlussbericht des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung
- TOP 31 „Raum geben“ - Zwischenbericht zu den Projekten „Aufbruch Quartier“ und „Aufbruch Wohnen“
- TOP 32 Abschlussbericht des Projekts „Zukunftsgutscheine”
- TOP 33 Zwischenbericht zum Fonds „#miteinander“
- TOP 34 Schlussbericht des Ausschusses für Diakonie
- TOP 35 Schlussbericht des Sonderausschusses für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte
- TOP 36 Abschluss der 16. Landessynode
- Gottesdienst mit Abendmahl in der Stiftskirche
Dokumente zu Tagesordnungspunkt 09
Beschluss
Die Landessynode hat dem neuen Gottesdienstbuch mit Antrag 27/25 mit großer Mehrheit zugestimmt.
Den vollständigen Bericht zu TOP 09 finden Sie in der Klappbox oben: Dokumente zu Tagesordnungspunkt 09
TOP 10 Bericht über die Situation der verfolgten Christen in der Welt sowie der Menschen, die aus religiösen, rassistischen, politischen, ethnischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gründen unter Verfolgung leiden – Schwerpunkt auf Syrien, Kolumbien, Nigeria und Pakistan
Alle Themen der Tagung
⬆️ Zum Seitenanfang
✳️Landessynode kompakt: Die wichtigsten Themen im Überblick
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente:
- Grußworte
- Verabschiedung der Unabhängigen Kommission zur Gewährung von Leistungen in Anerkennung des Leids Betroffener sexualisierter Gewalt und Verleihung der Silbernen Brenz-Medaille an den Vorsitzenden Wolfgang Vögele
- TOP 01 Strategische Planung
- TOP 02 Planüberschreitungen und Jahresabschluss der landeskirchlichen Rechnung 2024
TOP 03 1. Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 mit Kirchlichem Gesetz - TOP 04 Trauung gleichgeschlechtlich liebender Ehepaare
- TOP 05
- TOP 06 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung und des Gottesdienstes anlässlich der Eheschließung (Beilage 145)
- TOP 07 Kirchliches Gesetz zur Ablösung des Diakonen- und Diakoninnengesetzes und zur Änderung des Württ. Pfarrergesetzes (Beilage 141)
- TOP 08 Kirchliches Gesetz zur Änderung von Dienstverpflichtungen (Beilage 140)
- TOP 09 Gottesdienstbuch für die Ev. Landeskirche in Württemberg, Zweiter Teil, Teilband Einführungen und Verabschiedungen
- TOP 10 Bericht über die Situation der verfolgten Christen in der Welt sowie der Menschen, die aus religiösen, rassistischen, politischen, ethnischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gründen unter Verfolgung leiden – Schwerpunkt auf Syrien, Kolumbien, Nigeria und Pakistan
- TOP 11 Berichte des Beauftragten für die Entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs und des Islambeauftragten
- TOP 12 Aktuelle Stunde
- TOP 13 Schlussbericht des Ausschusses für Mission, Ökumene und Entwicklung
- TOP 14 Schlussbericht des Finanzausschusses
- TOP 15 Schlussbericht des Ausschusses für Bildung und Jugend
- TOP 16 Änderung des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes
- TOP 17 Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 18 Bericht der Projektstelle für die Themen Rassismus und Antisemitismus/Populismus und Extremismus
- Bildergalerie:Impressionen der Herbsttagung
- TOP 19 Abschaffung der Aktuellen Stunde
- TOP 20 OIKOS und die AKSB
- TOP 21 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (Beilage 142)
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (144)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Kirchengemeindeordnung und weiterer Regelungen (Beilage 143)
- TOP 24 Schlussbericht des Rechtsausschusses
- TOP 25 Selbständige Anträge
- TOP 26 Förmliche Anfragen
- TOP 27 Schlussbericht des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung
- TOP 28 Schlussbericht des Theologischen Ausschusses
- TOP 29 Abschlussbericht des Projekts „Geistlich Leiten, vom Geist geleitet“
- TOP 30 Schlussbericht des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung
- TOP 31 „Raum geben“ - Zwischenbericht zu den Projekten „Aufbruch Quartier“ und „Aufbruch Wohnen“
- TOP 32 Abschlussbericht des Projekts „Zukunftsgutscheine”
- TOP 33 Zwischenbericht zum Fonds „#miteinander“
- TOP 34 Schlussbericht des Ausschusses für Diakonie
- TOP 35 Schlussbericht des Sonderausschusses für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte
- TOP 36 Abschluss der 16. Landessynode
- Gottesdienst mit Abendmahl in der Stiftskirche
Dokumente zu Tagesordnungspunkt 10
Christen unter Druck - Blick auf Syrien, Kolumbien, Nigeria und Pakistan
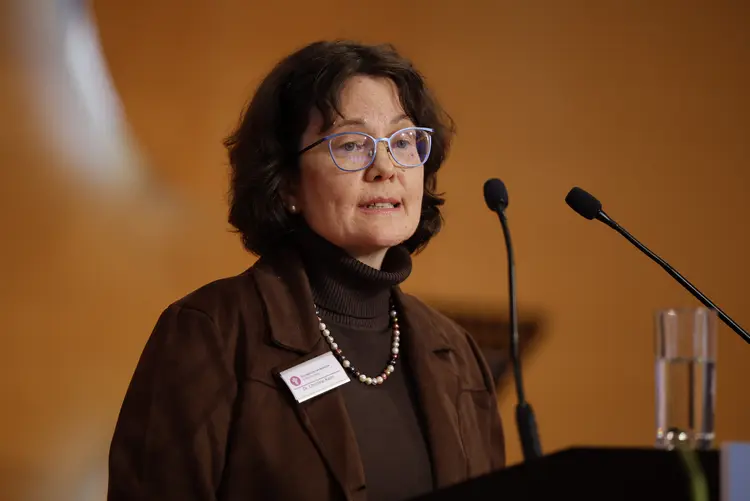
Die Lage von Christen ist in vielen Ländern angespannt. Dr. Christine Keim berichtete von Diskriminierung und Verfolgung. In beispielhaft genannten Ländern wirken u.a. politische und wirtschaftliche Faktoren. Helfen könnten internationale Fürsprache und interreligiöser Dialog.
Kirchenrätin Dr. Christine Keim, Leiterin des Referats für Mission, Ökumene und Entwicklung, berichtete über die Situation von Christen weltweit. Zu Beginn gab sie einen Überblick über die kirchlich-diakonische Flüchtlingsarbeit. Exemplarisch behandelte Dr. Keim:
- Syrien: Die Lage der Christen sei angespannt, man befürchte eine rasche Verschlechterung. Zur Unterstützung könnten u.a. internationale Fürsprache und interreligiöser Dialog verstärkt werden.
- Kolumbien: Trotz garantierter Religionsfreiheit gebe es Gewalt und Verfolgung, besonders in ländlichen Gebieten.
- Nigeria: Das Miteinander von Christen und Muslimen gerate immer mehr in Gefahr, u.a. durch Terrorgruppen wie Boko Haram und komplexe Ursachen wie Klimawandel und Bevölkerungswachstum.
- Pakistan: Christen würden als religiöse Minderheit diskriminiert und verfolgt, brächten sich aber auch stark in die Gesellschaft ein.
Keim erläuterte die Unterstützung der Christen in diesen Ländern durch die Landeskirche und/oder andere Stellen, wie den Lutherischen Weltbund. Sie berichtete kurz über die Lage in anderen Ländern, wie Indien, der Ukraine, im Libanon, im Sudan und in Israel. Dr. Keim schloss mit dem Hinweis auf die Verbundenheit der Landeskirche mit Partnerkirchen weltweit und auf die Friedensgedanken Gottes.
Aussprache
Der Synodale Dr. Chris Lehmann (Rietheim-Weilheim) bedankte sich für den Bericht, der ihn sehr bewegt habe. Er sei dankbar dafür, dass die evangelischen Christen in Württemberg immer wieder Gelegenheit hätten, am Leid der Geschwister und anderer Verfolgter weltweit Anteil zu nehmen. Er ergänzte den Bericht über Pakistan um eigene Erfahrungen aus einem Projekt seiner Hochschule mit einer islamischen Hochschule in Islamabad. Es gehe um Verfolgung, aber auch um Diskriminierung, um permanenten Druck, Benachteiligungen in Dutzenden von kleinen Situationen jeden Tag. Sie könnten Berufe nicht ergreifen, würden nicht befördert, sie würden mürbe gemacht. Über allem schwebe der Blasphemievorwurf. Es werde ein kaum vorstellbarer Konversionsdruck aufgebaut. Es gebe christliche Gemeinden, die ihre Mitglieder gezielt schulten, damit sie nicht in die Blasphemiefalle tappen, deren Schwelle sehr niedrig sei. Der Dialog tue not, und sei schwierig. Das hiesige Verständnis von Dialog – respektvoll, zurückhaltend, auf Augenhöhe – funktioniere nur begrenzt in einem Land, das sich als Gottesstaat einer Religion verstehe, und in dem die Mehrheitsverhältnisse erdrückend seien. Um so bewundernswerter sei es, dass dennoch Gespräche gelängen. Dr. Lehmann erzählte davon, dass Anfang Oktober der pakistanische Pastor Zafer Bhatti aus der Todeszelle entlassen worden sei, zum ersten Mal seit dem Fall Asia Bibi sei jemand, der zu Unrecht der Blasphemie angeklagt wurde, rehabilitiert worden sei. Beobachter hätten von einem Wunder gesprochen. Der Geistliche habe 13 Jahre in Haft verbracht; er sei zwei Tage nach seiner Freilassung verstorben. Die Hoffnung auf die Ewigkeit trage die Geschwister durch unsägliches Leid, und diese Hoffnung verbinde uns mit ihnen.
Die Synodale Maike Sachs (St. Johann-Gächingen) betonte, wie wichtig es sei die Verbindung zwischen der Lage der Menschen in Syrien und den geflüchteten Menschen aus dem Land, die wir hier sehen, vor Augen zu haben, damit wir ihnen ein Willkommen bieten. Ferner bestätigte sie, dass Verfolgung und Benachteiligung viele Faktoren haben, die man auseinanderhalten müsse. Sie berichtete von einer kürzlichen Reise nach Indien, die ihr wieder gezeigt habe, wie schwer es ist, als Christ dort in der Minderheit zu leben. Umso beeindruckender sei es, welche Fröhlichkeit und Lebendigkeit sie ausstrahlten. Die finanzielle Unterstützung aller benachteiligten Christen sei kostbar, auch diejenige durch kleine Player, die beharrlich und mit viel Fantasie arbeiteten. Maike Sachs gab ihrer Hoffnung Ausdruck, dass die Landeskirche – nach den aktuellen Kürzungen bei diesen Mitteln – in anderen Zeiten wieder verfolgte Christen weltweit an dem hiesigen Reichtum teilhaben lässt.
Der Synodale Anselm Kreh (Hermaringen) erklärte, es sei ihm ein Anliegen, für die wichtige Arbeit der landeskirchlichen Missionswerke, der Initiativen und Vereine, die sich unermüdlich für benachteiligte Minderheiten einsetzen, zu danken. Er dankte ferner dem Ausschuss für Mission, Ökumene und Entwicklung für seine Arbeit; diese sei umso wichtiger angesichts knapper werdender Mittel. Er regte an, die Einsparungen an Mitteln zur Bekämpfung von Fluchtursachen zu überdenken. Für die nächste Synode wünsche er sich, die Mitglieder der Synode aus den internationalen Gemeinden mehr in die synodale Arbeit einzubeziehen.
Der Synodale Dr. Markus Ehrmann (Rot am See) erklärte, der Bericht über die Situation verfolgter Christen bewege ihn jedes Jahr stark. Angesichts dessen, wie groß er kleine Probleme in seinem Leben werden lasse, und welche Probleme die Landeskirche beschäftigten. Es sei geboten, die Unterstützung nicht abreißen zu lassen. Zur Frage, was man hier vor Ort tun könne, schlug er vor, das Thema in die Debatte einzubringen, es an Mandatsträger heranzutragen. Bei Aufrufen zu Spenden sei es wichtig, den Blick auf Christen weltweit zu richten, denn in der Praxis spendeten die Menschen lieber für Projekte vor Ort, bei denen sie wüssten, wo das Geld hingeht.
Die Synodale Susanne Jäckle-Weckert (Forchtenberg) erklärte, dass es wichtig sei, sensibel zu sein gegenüber Christen und anderen verfolgten Menschen, die bei uns lebten. Es gebe Themen, die sie auch hier nicht ansprechen könnten. Vertrauen müsse wachsen, damit dies möglich sei. Sie selbst sei beeindruckt von der Resilienz, die die Menschen mitbrächten. Sie lebten mutig ihren Glauben und sprächen darüber; darin seien sie Vorbilder. Wir müssten die Stimme derer sein, die eingesperrt und verfolgt sind.
Der Synodale Jonas Elias (Schwieberdingen) drückt sein Bedauern darüber aus, dass Mittel der Unterstützung gekürzt worden seien. In über 60 Ländern der Erde würden Christen verfolgt. Als Möglichkeiten des Engagements der Christen hier nannte er – neben dem Gebet - sich an die Bundesregierung zu wenden, damit Geldzuwendungen an Bedingungen wie die Religionsfreiheit geknüpft würden.
Der Synodale Eckard Schultz-Berg (Stuttgart) betonte, dass auch in der digitalen Welt die persönliche Begegnung bedeutsam bleibe, und appellierte daran, die persönlichen Kontakte zu Christen in anderen Ländern zu nutzen.
Der Synodale Johannes Söhner (Herrenberg) stellte die Frage nach den Kooperationspartnern der Landeskirche; er habe erfahren, dass vor Ort manchmal gegeneinander gearbeitet würde.
Kirchenrätin Dr. Christine Keim erwiderte auf die Frage, dass mit den Kirchen vor Ort kooperiert würde, und man unbedingt vermeide, gegeneinander zu arbeiten. Man unterstütze ökumenische Kooperativen, und es werde immer das größere Wohl der dortigen Gesellschaft insgesamt angestrebt, nicht nur das der örtlichen Gemeinden.
Der TOP schloss mit einem Gebet des Landesbischofs.
Den vollständigen Bericht zu TOP 10 finden Sie in der Klappbox oben: Dokumente zu Tagesordnungspunkt 10
Hier werden externe Inhalte des (Dritt-)Anbieters ‘Meta Platforms - Instagram’ (Zweck: Soziale Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit) bereitgestellt. Mit Aktivierung des Dienstes stimmen Sie der in unserer Datenschutzinformation und in unserem Consent-Tool beschriebenen Datenverarbeitung zu.
Beitrag auf Instagram
Hier werden externe Inhalte des (Dritt-)Anbieters ‘Facebook’ (Zweck: Soziale Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit) bereitgestellt. Mit Aktivierung des Dienstes stimmen Sie der in unserer Datenschutzinformation und in unserem Consent-Tool beschriebenen Datenverarbeitung zu.
Beitrag auf Facebook
Hier werden externe Inhalte des (Dritt-)Anbieters ‘Meta Platforms - Instagram’ (Zweck: Soziale Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit) bereitgestellt. Mit Aktivierung des Dienstes stimmen Sie der in unserer Datenschutzinformation und in unserem Consent-Tool beschriebenen Datenverarbeitung zu.
Beitrag auf Instagram
Hier werden externe Inhalte des (Dritt-)Anbieters ‘Facebook’ (Zweck: Soziale Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit) bereitgestellt. Mit Aktivierung des Dienstes stimmen Sie der in unserer Datenschutzinformation und in unserem Consent-Tool beschriebenen Datenverarbeitung zu.
Beitrag auf Facebook
TOP 11 Berichte des Beauftragten für die Entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs und des Islambeauftragten
Alle Themen der Tagung
⬆️ Zum Seitenanfang
✳️Landessynode kompakt: Die wichtigsten Themen im Überblick
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente:
- Grußworte
- Verabschiedung der Unabhängigen Kommission zur Gewährung von Leistungen in Anerkennung des Leids Betroffener sexualisierter Gewalt und Verleihung der Silbernen Brenz-Medaille an den Vorsitzenden Wolfgang Vögele
- TOP 01 Strategische Planung
- TOP 02 Planüberschreitungen und Jahresabschluss der landeskirchlichen Rechnung 2024
TOP 03 1. Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 mit Kirchlichem Gesetz - TOP 04 Trauung gleichgeschlechtlich liebender Ehepaare
- TOP 05
- TOP 06 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung und des Gottesdienstes anlässlich der Eheschließung (Beilage 145)
- TOP 07 Kirchliches Gesetz zur Ablösung des Diakonen- und Diakoninnengesetzes und zur Änderung des Württ. Pfarrergesetzes (Beilage 141)
- TOP 08 Kirchliches Gesetz zur Änderung von Dienstverpflichtungen (Beilage 140)
- TOP 09 Gottesdienstbuch für die Ev. Landeskirche in Württemberg, Zweiter Teil, Teilband Einführungen und Verabschiedungen
- TOP 10 Bericht über die Situation der verfolgten Christen in der Welt sowie der Menschen, die aus religiösen, rassistischen, politischen, ethnischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gründen unter Verfolgung leiden – Schwerpunkt auf Syrien, Kolumbien, Nigeria und Pakistan
- TOP 11 Berichte des Beauftragten für die Entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs und des Islambeauftragten
- TOP 12 Aktuelle Stunde
- TOP 13 Schlussbericht des Ausschusses für Mission, Ökumene und Entwicklung
- TOP 14 Schlussbericht des Finanzausschusses
- TOP 15 Schlussbericht des Ausschusses für Bildung und Jugend
- TOP 16 Änderung des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes
- TOP 17 Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 18 Bericht der Projektstelle für die Themen Rassismus und Antisemitismus/Populismus und Extremismus
- Bildergalerie:Impressionen der Herbsttagung
- TOP 19 Abschaffung der Aktuellen Stunde
- TOP 20 OIKOS und die AKSB
- TOP 21 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (Beilage 142)
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (144)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Kirchengemeindeordnung und weiterer Regelungen (Beilage 143)
- TOP 24 Schlussbericht des Rechtsausschusses
- TOP 25 Selbständige Anträge
- TOP 26 Förmliche Anfragen
- TOP 27 Schlussbericht des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung
- TOP 28 Schlussbericht des Theologischen Ausschusses
- TOP 29 Abschlussbericht des Projekts „Geistlich Leiten, vom Geist geleitet“
- TOP 30 Schlussbericht des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung
- TOP 31 „Raum geben“ - Zwischenbericht zu den Projekten „Aufbruch Quartier“ und „Aufbruch Wohnen“
- TOP 32 Abschlussbericht des Projekts „Zukunftsgutscheine”
- TOP 33 Zwischenbericht zum Fonds „#miteinander“
- TOP 34 Schlussbericht des Ausschusses für Diakonie
- TOP 35 Schlussbericht des Sonderausschusses für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte
- TOP 36 Abschluss der 16. Landessynode
- Gottesdienst mit Abendmahl in der Stiftskirche
Dokumente zu Tagesordnungspunkt 11
Beauftragte rufen zu mehr Begegnung mit Judentum und Islam auf

Der Beauftragte für die Entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs der Landeskirchen in Württemberg und Baden, Pfarrer Jochen Maurer, begann seinen Bericht mit der Erläuterung einiger Wegmarken seit April 2020. Die Ereignisse des 7. Oktober 2023 ordnete er als tiefe Zäsur ein und bezeichnete die zwei Jahre Krieg in Gaza als „zwei Jahre des Schreckens“ und „Katastrophe für alle, die dort leben“. In Deutschland sehe Maurer eine erfreuliche Entwicklung, indem Jüdinnen und Juden als ein wichtiger Teil der Gesellschaft und die jüdische Gemeinde als ein Gegenüber auf Augenhöhe akzeptiert werden. Dennoch appellierte Maurer dafür, Antisemitismus als Bildungsaufgabe zu begreifen, die nur im Zusammenspiel vieler gesellschaftlicher Träger und Institutionen wirksam angegangen werden könne, und nahm dabei auch die Landeskirche in die Pflicht. Schließlich hätten Christinnen und Christen „eine Lebensbeziehung zu jüdischer Religion, Geschichte und Gemeinschaft – von Anfang an und bis auf den heutigen Tag“.

Im Anschluss gab Pfarrer Dr. Friedmann Eißler, Islambeauftragter der Landeskirchen in Württemberg und Baden, einen Einblick in seine Arbeit seit Frühjahr 2021, aber auch einen Rückblick auf die Aufgabenbereiche der früheren Islambeauftragten. Wie Maurer begreift Eißler den 7. Oktober 2023 als Einschnitt, in seinem Fall als Zäsur im Dialog mit dem Islam. Anschaulich beschrieb Eißler, wie sich das Verhältnis zwischen Landeskirche und Islam über die Jahre verändert habe. Er nannte die Stichworte Information, Dialog, aber auch Umgang mit Radikalisierung, Beitrag zum gesellschaftlichen Frieden und Partizipation. Dabei hob er die „wichtige Begleit- und Aufbauarbeit“ der Kirchen hervor. Eißler forderte die Synodalen auf, die Entwicklungen im Islamismus und islamisch-religiös unterfüttertem Nationalismus wahr- und ernst zu nehmen. Dennoch befürworte er den Dialog und das Zutun zum guten Miteinander, um Menschen zu gewinnen und nicht zu verlieren, „in aller Verschiedenheit, in allem Respekt“.
Den vollständigen Bericht zu TOP 11 finden Sie in der Klappbox oben: Dokumente zu Tagesordnungspunkt 11
TOP 12 Aktuelle Stunde
Alle Themen der Tagung
⬆️ Zum Seitenanfang
✳️Landessynode kompakt: Die wichtigsten Themen im Überblick
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente:
- Grußworte
- Verabschiedung der Unabhängigen Kommission zur Gewährung von Leistungen in Anerkennung des Leids Betroffener sexualisierter Gewalt und Verleihung der Silbernen Brenz-Medaille an den Vorsitzenden Wolfgang Vögele
- TOP 01 Strategische Planung
- TOP 02 Planüberschreitungen und Jahresabschluss der landeskirchlichen Rechnung 2024
TOP 03 1. Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 mit Kirchlichem Gesetz - TOP 04 Trauung gleichgeschlechtlich liebender Ehepaare
- TOP 05
- TOP 06 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung und des Gottesdienstes anlässlich der Eheschließung (Beilage 145)
- TOP 07 Kirchliches Gesetz zur Ablösung des Diakonen- und Diakoninnengesetzes und zur Änderung des Württ. Pfarrergesetzes (Beilage 141)
- TOP 08 Kirchliches Gesetz zur Änderung von Dienstverpflichtungen (Beilage 140)
- TOP 09 Gottesdienstbuch für die Ev. Landeskirche in Württemberg, Zweiter Teil, Teilband Einführungen und Verabschiedungen
- TOP 10 Bericht über die Situation der verfolgten Christen in der Welt sowie der Menschen, die aus religiösen, rassistischen, politischen, ethnischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gründen unter Verfolgung leiden – Schwerpunkt auf Syrien, Kolumbien, Nigeria und Pakistan
- TOP 11 Berichte des Beauftragten für die Entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs und des Islambeauftragten
- TOP 12 Aktuelle Stunde
- TOP 13 Schlussbericht des Ausschusses für Mission, Ökumene und Entwicklung
- TOP 14 Schlussbericht des Finanzausschusses
- TOP 15 Schlussbericht des Ausschusses für Bildung und Jugend
- TOP 16 Änderung des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes
- TOP 17 Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 18 Bericht der Projektstelle für die Themen Rassismus und Antisemitismus/Populismus und Extremismus
- Bildergalerie:Impressionen der Herbsttagung
- TOP 19 Abschaffung der Aktuellen Stunde
- TOP 20 OIKOS und die AKSB
- TOP 21 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (Beilage 142)
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (144)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Kirchengemeindeordnung und weiterer Regelungen (Beilage 143)
- TOP 24 Schlussbericht des Rechtsausschusses
- TOP 25 Selbständige Anträge
- TOP 26 Förmliche Anfragen
- TOP 27 Schlussbericht des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung
- TOP 28 Schlussbericht des Theologischen Ausschusses
- TOP 29 Abschlussbericht des Projekts „Geistlich Leiten, vom Geist geleitet“
- TOP 30 Schlussbericht des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung
- TOP 31 „Raum geben“ - Zwischenbericht zu den Projekten „Aufbruch Quartier“ und „Aufbruch Wohnen“
- TOP 32 Abschlussbericht des Projekts „Zukunftsgutscheine”
- TOP 33 Zwischenbericht zum Fonds „#miteinander“
- TOP 34 Schlussbericht des Ausschusses für Diakonie
- TOP 35 Schlussbericht des Sonderausschusses für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte
- TOP 36 Abschluss der 16. Landessynode
- Gottesdienst mit Abendmahl in der Stiftskirche
Dokumente zu Tagesordnungspunkt 12
Es fand keine Aktuelle Stunde statt
Es fand keine aktuelle Stunde statt
TOP 13 Schlussbericht des Ausschusses für Mission, Ökumene und Entwicklung
Alle Themen der Tagung
⬆️ Zum Seitenanfang
✳️Landessynode kompakt: Die wichtigsten Themen im Überblick
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente:
- Grußworte
- Verabschiedung der Unabhängigen Kommission zur Gewährung von Leistungen in Anerkennung des Leids Betroffener sexualisierter Gewalt und Verleihung der Silbernen Brenz-Medaille an den Vorsitzenden Wolfgang Vögele
- TOP 01 Strategische Planung
- TOP 02 Planüberschreitungen und Jahresabschluss der landeskirchlichen Rechnung 2024
TOP 03 1. Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 mit Kirchlichem Gesetz - TOP 04 Trauung gleichgeschlechtlich liebender Ehepaare
- TOP 05
- TOP 06 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung und des Gottesdienstes anlässlich der Eheschließung (Beilage 145)
- TOP 07 Kirchliches Gesetz zur Ablösung des Diakonen- und Diakoninnengesetzes und zur Änderung des Württ. Pfarrergesetzes (Beilage 141)
- TOP 08 Kirchliches Gesetz zur Änderung von Dienstverpflichtungen (Beilage 140)
- TOP 09 Gottesdienstbuch für die Ev. Landeskirche in Württemberg, Zweiter Teil, Teilband Einführungen und Verabschiedungen
- TOP 10 Bericht über die Situation der verfolgten Christen in der Welt sowie der Menschen, die aus religiösen, rassistischen, politischen, ethnischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gründen unter Verfolgung leiden – Schwerpunkt auf Syrien, Kolumbien, Nigeria und Pakistan
- TOP 11 Berichte des Beauftragten für die Entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs und des Islambeauftragten
- TOP 12 Aktuelle Stunde
- TOP 13 Schlussbericht des Ausschusses für Mission, Ökumene und Entwicklung
- TOP 14 Schlussbericht des Finanzausschusses
- TOP 15 Schlussbericht des Ausschusses für Bildung und Jugend
- TOP 16 Änderung des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes
- TOP 17 Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 18 Bericht der Projektstelle für die Themen Rassismus und Antisemitismus/Populismus und Extremismus
- Bildergalerie:Impressionen der Herbsttagung
- TOP 19 Abschaffung der Aktuellen Stunde
- TOP 20 OIKOS und die AKSB
- TOP 21 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (Beilage 142)
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (144)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Kirchengemeindeordnung und weiterer Regelungen (Beilage 143)
- TOP 24 Schlussbericht des Rechtsausschusses
- TOP 25 Selbständige Anträge
- TOP 26 Förmliche Anfragen
- TOP 27 Schlussbericht des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung
- TOP 28 Schlussbericht des Theologischen Ausschusses
- TOP 29 Abschlussbericht des Projekts „Geistlich Leiten, vom Geist geleitet“
- TOP 30 Schlussbericht des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung
- TOP 31 „Raum geben“ - Zwischenbericht zu den Projekten „Aufbruch Quartier“ und „Aufbruch Wohnen“
- TOP 32 Abschlussbericht des Projekts „Zukunftsgutscheine”
- TOP 33 Zwischenbericht zum Fonds „#miteinander“
- TOP 34 Schlussbericht des Ausschusses für Diakonie
- TOP 35 Schlussbericht des Sonderausschusses für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte
- TOP 36 Abschluss der 16. Landessynode
- Gottesdienst mit Abendmahl in der Stiftskirche
Dokumente zu Tagesordnungspunkt 13
Die Landeskirche lebt von den internationalen Beziehungen
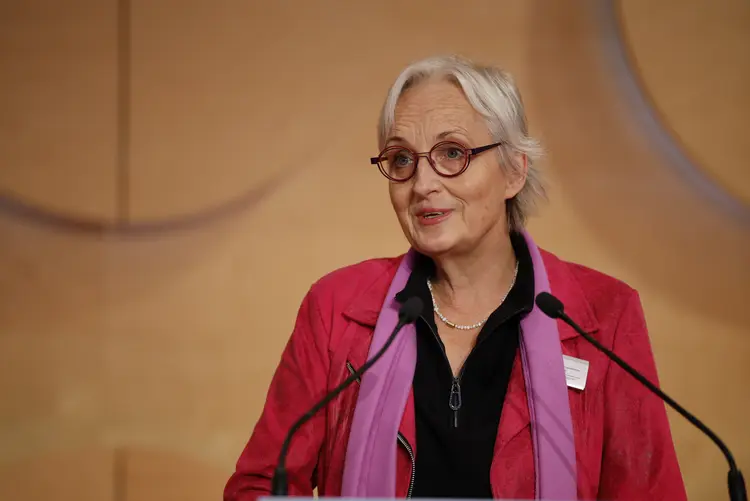
Yasna Crüsemann, Vorsitzende des Ausschusses für Mission, Ökumene und Entwicklung, griff in ihrem Schlussbericht drei zentrale Themen heraus. Das neue Missionsverständnis der Landeskirche, die Integration internationaler Gemeinden und der Umgang mit Flucht und Migration seien intensiv bearbeitet worden. Trotz finanzieller Kürzungen und gesellschaftlicher Herausforderungen bleibe die weltweite Verbundenheit ein zentraler Bestandteil der kirchlichen Identität und Arbeit.
Den vollständigen Bericht zu TOP 13 finden Sie in der Klappbox oben: Dokumente zu Tagesordnungspunkt 13
TOP 14 Schlussbericht des Finanzausschusses
Alle Themen der Tagung
⬆️ Zum Seitenanfang
✳️Landessynode kompakt: Die wichtigsten Themen im Überblick
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente:
- Grußworte
- Verabschiedung der Unabhängigen Kommission zur Gewährung von Leistungen in Anerkennung des Leids Betroffener sexualisierter Gewalt und Verleihung der Silbernen Brenz-Medaille an den Vorsitzenden Wolfgang Vögele
- TOP 01 Strategische Planung
- TOP 02 Planüberschreitungen und Jahresabschluss der landeskirchlichen Rechnung 2024
TOP 03 1. Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 mit Kirchlichem Gesetz - TOP 04 Trauung gleichgeschlechtlich liebender Ehepaare
- TOP 05
- TOP 06 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung und des Gottesdienstes anlässlich der Eheschließung (Beilage 145)
- TOP 07 Kirchliches Gesetz zur Ablösung des Diakonen- und Diakoninnengesetzes und zur Änderung des Württ. Pfarrergesetzes (Beilage 141)
- TOP 08 Kirchliches Gesetz zur Änderung von Dienstverpflichtungen (Beilage 140)
- TOP 09 Gottesdienstbuch für die Ev. Landeskirche in Württemberg, Zweiter Teil, Teilband Einführungen und Verabschiedungen
- TOP 10 Bericht über die Situation der verfolgten Christen in der Welt sowie der Menschen, die aus religiösen, rassistischen, politischen, ethnischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gründen unter Verfolgung leiden – Schwerpunkt auf Syrien, Kolumbien, Nigeria und Pakistan
- TOP 11 Berichte des Beauftragten für die Entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs und des Islambeauftragten
- TOP 12 Aktuelle Stunde
- TOP 13 Schlussbericht des Ausschusses für Mission, Ökumene und Entwicklung
- TOP 14 Schlussbericht des Finanzausschusses
- TOP 15 Schlussbericht des Ausschusses für Bildung und Jugend
- TOP 16 Änderung des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes
- TOP 17 Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 18 Bericht der Projektstelle für die Themen Rassismus und Antisemitismus/Populismus und Extremismus
- Bildergalerie:Impressionen der Herbsttagung
- TOP 19 Abschaffung der Aktuellen Stunde
- TOP 20 OIKOS und die AKSB
- TOP 21 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (Beilage 142)
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (144)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Kirchengemeindeordnung und weiterer Regelungen (Beilage 143)
- TOP 24 Schlussbericht des Rechtsausschusses
- TOP 25 Selbständige Anträge
- TOP 26 Förmliche Anfragen
- TOP 27 Schlussbericht des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung
- TOP 28 Schlussbericht des Theologischen Ausschusses
- TOP 29 Abschlussbericht des Projekts „Geistlich Leiten, vom Geist geleitet“
- TOP 30 Schlussbericht des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung
- TOP 31 „Raum geben“ - Zwischenbericht zu den Projekten „Aufbruch Quartier“ und „Aufbruch Wohnen“
- TOP 32 Abschlussbericht des Projekts „Zukunftsgutscheine”
- TOP 33 Zwischenbericht zum Fonds „#miteinander“
- TOP 34 Schlussbericht des Ausschusses für Diakonie
- TOP 35 Schlussbericht des Sonderausschusses für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte
- TOP 36 Abschluss der 16. Landessynode
- Gottesdienst mit Abendmahl in der Stiftskirche
Dokumente zu Tagesordnungspunkt 14
Geld ist in der Kirche nicht das Wichtigste

Tobias Geiger, Vorsitzender des Finanzausschusses, sprach in dem Schlussbericht des Finanzausschusses die finanziellen Herausforderungen und strukturellen Veränderungen der württembergischen Landeskirche, insbesondere durch Mitgliederschwund, die Corona-Pandemie und steigende Kosten an. Als die markantesten Punkte nannte er den Doppelhaushalt, Eckwerte- und Maßnahmenplanung, die “Nicht verplante Million”, Zukunft der Tagungsstätten und die Haushaltskonsolidierungs- und Versorgungsdeckungsstrategie. Abschließend gab Geiger zu bedenken, dass Geld nicht das Wichtigste in der Kirche sei, sondern Gottes Führung und Leitung.
Den vollständigen Bericht zu TOP 14 finden Sie in der Klappbox oben: Dokumente zu Tagesordnungspunkt 14
TOP 15 Schlussbericht des Ausschusses für Bildung und Jugend
Alle Themen der Tagung
⬆️ Zum Seitenanfang
✳️Landessynode kompakt: Die wichtigsten Themen im Überblick
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente:
- Grußworte
- Verabschiedung der Unabhängigen Kommission zur Gewährung von Leistungen in Anerkennung des Leids Betroffener sexualisierter Gewalt und Verleihung der Silbernen Brenz-Medaille an den Vorsitzenden Wolfgang Vögele
- TOP 01 Strategische Planung
- TOP 02 Planüberschreitungen und Jahresabschluss der landeskirchlichen Rechnung 2024
TOP 03 1. Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 mit Kirchlichem Gesetz - TOP 04 Trauung gleichgeschlechtlich liebender Ehepaare
- TOP 05
- TOP 06 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung und des Gottesdienstes anlässlich der Eheschließung (Beilage 145)
- TOP 07 Kirchliches Gesetz zur Ablösung des Diakonen- und Diakoninnengesetzes und zur Änderung des Württ. Pfarrergesetzes (Beilage 141)
- TOP 08 Kirchliches Gesetz zur Änderung von Dienstverpflichtungen (Beilage 140)
- TOP 09 Gottesdienstbuch für die Ev. Landeskirche in Württemberg, Zweiter Teil, Teilband Einführungen und Verabschiedungen
- TOP 10 Bericht über die Situation der verfolgten Christen in der Welt sowie der Menschen, die aus religiösen, rassistischen, politischen, ethnischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gründen unter Verfolgung leiden – Schwerpunkt auf Syrien, Kolumbien, Nigeria und Pakistan
- TOP 11 Berichte des Beauftragten für die Entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs und des Islambeauftragten
- TOP 12 Aktuelle Stunde
- TOP 13 Schlussbericht des Ausschusses für Mission, Ökumene und Entwicklung
- TOP 14 Schlussbericht des Finanzausschusses
- TOP 15 Schlussbericht des Ausschusses für Bildung und Jugend
- TOP 16 Änderung des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes
- TOP 17 Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 18 Bericht der Projektstelle für die Themen Rassismus und Antisemitismus/Populismus und Extremismus
- Bildergalerie:Impressionen der Herbsttagung
- TOP 19 Abschaffung der Aktuellen Stunde
- TOP 20 OIKOS und die AKSB
- TOP 21 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (Beilage 142)
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (144)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Kirchengemeindeordnung und weiterer Regelungen (Beilage 143)
- TOP 24 Schlussbericht des Rechtsausschusses
- TOP 25 Selbständige Anträge
- TOP 26 Förmliche Anfragen
- TOP 27 Schlussbericht des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung
- TOP 28 Schlussbericht des Theologischen Ausschusses
- TOP 29 Abschlussbericht des Projekts „Geistlich Leiten, vom Geist geleitet“
- TOP 30 Schlussbericht des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung
- TOP 31 „Raum geben“ - Zwischenbericht zu den Projekten „Aufbruch Quartier“ und „Aufbruch Wohnen“
- TOP 32 Abschlussbericht des Projekts „Zukunftsgutscheine”
- TOP 33 Zwischenbericht zum Fonds „#miteinander“
- TOP 34 Schlussbericht des Ausschusses für Diakonie
- TOP 35 Schlussbericht des Sonderausschusses für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte
- TOP 36 Abschluss der 16. Landessynode
- Gottesdienst mit Abendmahl in der Stiftskirche
Dokumente zu Tagesordnungspunkt 15
„Bildung gehört zur DNA einer reformatorischen Kirche“

Siegfried Jahn, Vorsitzender des Ausschusses für Bildung und Jugend, resümierte in seinem Schlussbericht, dass bei der Arbeit des Ausschusses der Bildungsgesamtprozess im Mittelpunkt gestanden habe – ein dynamischer, vernetzter Ansatz zur Bildungsarbeit, der aktuelle Themen wie Digitalisierung, KI und Bedarfsorientierung aufgreife.
Als besonders erfolgreich stellte er die Neustrukturierung des Evangelischen Bildungswerks heraus, bei der ehemals getrennte Bildungsbereiche unter ein gemeinsames Dach gebracht wurden, um Synergien zu schaffen und Doppelstrukturen abzubauen. Zudem seien verschiedene Studien zur Familien- und Jugendarbeit ausgewertet worden, mit dem Ziel, deren Erkenntnisse zusammenzuführen und daraus fundierte Grundlagen für die künftige Arbeit der neuen Synode zu entwickeln.
Den vollständigen Bericht zu TOP 15 finden Sie in der Klappbox oben: Dokumente zu Tagesordnungspunkt 15
TOP 16 Änderung des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes
Alle Themen der Tagung
⬆️ Zum Seitenanfang
✳️Landessynode kompakt: Die wichtigsten Themen im Überblick
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente:
- Grußworte
- Verabschiedung der Unabhängigen Kommission zur Gewährung von Leistungen in Anerkennung des Leids Betroffener sexualisierter Gewalt und Verleihung der Silbernen Brenz-Medaille an den Vorsitzenden Wolfgang Vögele
- TOP 01 Strategische Planung
- TOP 02 Planüberschreitungen und Jahresabschluss der landeskirchlichen Rechnung 2024
TOP 03 1. Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 mit Kirchlichem Gesetz - TOP 04 Trauung gleichgeschlechtlich liebender Ehepaare
- TOP 05
- TOP 06 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung und des Gottesdienstes anlässlich der Eheschließung (Beilage 145)
- TOP 07 Kirchliches Gesetz zur Ablösung des Diakonen- und Diakoninnengesetzes und zur Änderung des Württ. Pfarrergesetzes (Beilage 141)
- TOP 08 Kirchliches Gesetz zur Änderung von Dienstverpflichtungen (Beilage 140)
- TOP 09 Gottesdienstbuch für die Ev. Landeskirche in Württemberg, Zweiter Teil, Teilband Einführungen und Verabschiedungen
- TOP 10 Bericht über die Situation der verfolgten Christen in der Welt sowie der Menschen, die aus religiösen, rassistischen, politischen, ethnischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gründen unter Verfolgung leiden – Schwerpunkt auf Syrien, Kolumbien, Nigeria und Pakistan
- TOP 11 Berichte des Beauftragten für die Entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs und des Islambeauftragten
- TOP 12 Aktuelle Stunde
- TOP 13 Schlussbericht des Ausschusses für Mission, Ökumene und Entwicklung
- TOP 14 Schlussbericht des Finanzausschusses
- TOP 15 Schlussbericht des Ausschusses für Bildung und Jugend
- TOP 16 Änderung des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes
- TOP 17 Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 18 Bericht der Projektstelle für die Themen Rassismus und Antisemitismus/Populismus und Extremismus
- Bildergalerie:Impressionen der Herbsttagung
- TOP 19 Abschaffung der Aktuellen Stunde
- TOP 20 OIKOS und die AKSB
- TOP 21 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (Beilage 142)
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (144)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Kirchengemeindeordnung und weiterer Regelungen (Beilage 143)
- TOP 24 Schlussbericht des Rechtsausschusses
- TOP 25 Selbständige Anträge
- TOP 26 Förmliche Anfragen
- TOP 27 Schlussbericht des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung
- TOP 28 Schlussbericht des Theologischen Ausschusses
- TOP 29 Abschlussbericht des Projekts „Geistlich Leiten, vom Geist geleitet“
- TOP 30 Schlussbericht des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung
- TOP 31 „Raum geben“ - Zwischenbericht zu den Projekten „Aufbruch Quartier“ und „Aufbruch Wohnen“
- TOP 32 Abschlussbericht des Projekts „Zukunftsgutscheine”
- TOP 33 Zwischenbericht zum Fonds „#miteinander“
- TOP 34 Schlussbericht des Ausschusses für Diakonie
- TOP 35 Schlussbericht des Sonderausschusses für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte
- TOP 36 Abschluss der 16. Landessynode
- Gottesdienst mit Abendmahl in der Stiftskirche
Dokumente zu Tagesordnungspunkt 16
Antrag: Eigenverantwortliches Handeln der Kirchengemeinden stärken

In der Herbstsynode 2024 war ein Antrag eingebracht worden, der darauf abzielte, den Kirchengemeinden zu ermöglichen, Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung ohne Beteiligung der Landeskirche zu erledigen. Der Rechtsausschuss legt den Antrag der Synode jetzt zur Entscheidung vor.
Prof. Dr. Martin Plümicke, Stellv. Vorsitzender des Rechtsausschusses, erläuterte den Inhalt des Antrags Nr. 35/24, der im Rahmen der Herbstsynode 2024 eingebracht worden war. Ziel war eine Gesetzesänderung dahingehend, den Kirchengemeinden die Möglichkeit zu gewähren, ihre Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung ganz oder teilweise ohne Beteiligung der Landeskirche zu erledigen.
Der Rechtsausschuss hatte den Ausschuss für Kirche und Gemeindeentwicklung (KGE) um eine Stellungnahme gebeten. Dieser habe dem Rechtsausschuss empfohlen, den Antrag nicht weiterzuverfolgen, da er einen Rückschritt gegenüber bereits beschlossenen Verwaltungsstrukturen darstelle. Er habe empfohlen, in der weiteren Umsetzung besonders auf die Unterstützung der Kirchengemeinden zu achten.
Der Rechtsausschuss habe demgegenüber die Frage der faktischen Zuständigkeit erörtert. Bei den Kirchengemeinden sei Verunsicherung entstanden, was das Vorgehen bei unterschiedlicher Rechtsauffassung zwischen Ev. Regionalverwaltung und Kirchengemeinde betreffe. Der Antragsteller habe eine Abwertung der Rolle der Kirchengemeinden gesehen.
Aus Sicht des Oberkirchenrats ändere sich rechtlich wenig, es gebe etablierte Verfahren zur Klärung von Dissens.
Der Rechtsausschuss legt Antrag Nr. 35/24 zum Beschluss vor.
Wortmeldung des Oberkirchenrats

Oberkirchenrat Dr. Michael Frisch gab zu Antrag Nr. 35/24 zunächst die derzeitige Rechtslage des § 41 Abs. 4 Kirchengemeindeordnung zu bedenken, nach der lediglich die Bearbeitung der Aufgaben, nicht aber die Sachentscheidung auf die Regionalverwaltungen übertragen würden. Sinn und Zweck sei die Bündelung von Aufgaben, die immer komplexer würden.
Zur Kritik der Antragsteller in Bezug auf das Selbstverwaltungsrecht der Kirchengemeinden sagte er, dieses bleibe vollständig gewahrt. Zur Rechtsaufsicht führte er aus, dass sich durch die neue Handreichung nichts an der Rechtslage geändert habe. Die unmittelbare Aufsicht über die Kirchengemeinden obliege weiterhin dem Dekanatamt, die Oberaufsicht dem Oberkirchenrat, nicht den Regionalverwaltungen.
Die Aufnahme konkreter Bedingungen für die Aufgabenübertragung an Dritte sei nicht zielführend. Grundsätzliche Bedenken äußerte Dr. Frisch dahingehend, dass eine erneute Änderung der Rahmenbedingungen für einen stark erhöhten Kommunikationsaufwand und Verunsicherung sorgen würde. Insgesamt zeige auch der Vergleich mit anderen Landeskirchen, dass die Entwicklung in Richtung zentralisierter Strukturen effizienter und rechtssicherer sei, und bessere Perspektiven für Mitarbeitende aufweise.
Daher empfehle er, dem Antrag nicht zuzustimmen.
Aussprache
Der Synodale Eckart Schulz-Berg (Stuttgart) stimmte den Ausführungen von Oberkirchenrat Dr. Frisch zu. Er wies jedoch darauf hin, dass sich in der Praxis die Machtverhältnisse sehr verschöben. Er bat darum, bei der Ausführung der Bestimmungen immer wieder deutlich zu machen, dass die Kirchengemeinden trotz allem souverän und die Regionalverwaltungen Dienstleister seien.
Der Synodale Peter Reif (Stuttgart) betonte, dass sich sowohl Kirchengemeinden als auch Regionalverwaltungen in einem Entwicklungsprozess befänden. Als noch zu klärende Frage aus der Praxis nannte er, dass zur Zeit der Ferienwaldheime im Sommer weiterhin Bargeldkassen benötigt würden. In solchen Fällen gelte es, Lösungen zu finden, und die Entwicklung zu koordinieren.
Prof. Dr. Martin Plümicke (Reutlingen) erklärte vorab, in seiner Wortmeldung als Synodaler und Erstunterzeichner des Antrags zu sprechen, und nicht als Ausschussvorsitzender. Den von Oberkirchenrat Dr. Frisch genannten Punkten stimme er zu, wies aber darauf hin, dass es bei diesem Antrag nicht um einen Gesetzentwurf gehe, sondern um die Bitte, das Gesetz noch einmal zu überarbeiten. Es gehe um die Möglichkeit, dass Kirchengemeinden ihre Angelegenheiten auch selbständig erledigen können. Alle genannten Aspekte könne man bei einer Änderung als Bedingungen in einem Gesetz festhalten.
Der Synodale Kai Münzing (Dettingen an der Erms) gab den Ausführungen des Synodalen Prof. Dr. Martin Plümicke recht, dass es Kirchengemeinden geben könne, die alle Bedingungen erfüllten. Genau diese würden aber benötigt, um in dem Solidarsystem die Kleineren zu stützen. Er bat, den Antrag nicht mehr zu verfolgen, und die 17. Landessynode, den Prozess der Verwaltungsstrukturreform aufmerksam zu begleiten, und ggf. nachzujustieren.
Oberkirchenrat Christian Schuler erwiderte, dass es in der Tat Handvorschüsse oder Debitkarten geben werde; die einzelnen Regionalverwaltungen müssten handeln können. Vorschriften seien immer zugunsten der Kirchengemeinden auszulegen.
Beschluss
Der Antrag Nr. 35/24 erhielt nicht die erforderliche Mehrheit und wird nicht weiterverfolgt.
Den vollständigen Bericht zu TOP 16 finden Sie in der Klappbox oben: Dokumente zu Tagesordnungspunkt 16
TOP 17 Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
Alle Themen der Tagung
⬆️ Zum Seitenanfang
✳️Landessynode kompakt: Die wichtigsten Themen im Überblick
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente:
- Grußworte
- Verabschiedung der Unabhängigen Kommission zur Gewährung von Leistungen in Anerkennung des Leids Betroffener sexualisierter Gewalt und Verleihung der Silbernen Brenz-Medaille an den Vorsitzenden Wolfgang Vögele
- TOP 01 Strategische Planung
- TOP 02 Planüberschreitungen und Jahresabschluss der landeskirchlichen Rechnung 2024
TOP 03 1. Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 mit Kirchlichem Gesetz - TOP 04 Trauung gleichgeschlechtlich liebender Ehepaare
- TOP 05
- TOP 06 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung und des Gottesdienstes anlässlich der Eheschließung (Beilage 145)
- TOP 07 Kirchliches Gesetz zur Ablösung des Diakonen- und Diakoninnengesetzes und zur Änderung des Württ. Pfarrergesetzes (Beilage 141)
- TOP 08 Kirchliches Gesetz zur Änderung von Dienstverpflichtungen (Beilage 140)
- TOP 09 Gottesdienstbuch für die Ev. Landeskirche in Württemberg, Zweiter Teil, Teilband Einführungen und Verabschiedungen
- TOP 10 Bericht über die Situation der verfolgten Christen in der Welt sowie der Menschen, die aus religiösen, rassistischen, politischen, ethnischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gründen unter Verfolgung leiden – Schwerpunkt auf Syrien, Kolumbien, Nigeria und Pakistan
- TOP 11 Berichte des Beauftragten für die Entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs und des Islambeauftragten
- TOP 12 Aktuelle Stunde
- TOP 13 Schlussbericht des Ausschusses für Mission, Ökumene und Entwicklung
- TOP 14 Schlussbericht des Finanzausschusses
- TOP 15 Schlussbericht des Ausschusses für Bildung und Jugend
- TOP 16 Änderung des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes
- TOP 17 Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 18 Bericht der Projektstelle für die Themen Rassismus und Antisemitismus/Populismus und Extremismus
- Bildergalerie:Impressionen der Herbsttagung
- TOP 19 Abschaffung der Aktuellen Stunde
- TOP 20 OIKOS und die AKSB
- TOP 21 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (Beilage 142)
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (144)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Kirchengemeindeordnung und weiterer Regelungen (Beilage 143)
- TOP 24 Schlussbericht des Rechtsausschusses
- TOP 25 Selbständige Anträge
- TOP 26 Förmliche Anfragen
- TOP 27 Schlussbericht des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung
- TOP 28 Schlussbericht des Theologischen Ausschusses
- TOP 29 Abschlussbericht des Projekts „Geistlich Leiten, vom Geist geleitet“
- TOP 30 Schlussbericht des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung
- TOP 31 „Raum geben“ - Zwischenbericht zu den Projekten „Aufbruch Quartier“ und „Aufbruch Wohnen“
- TOP 32 Abschlussbericht des Projekts „Zukunftsgutscheine”
- TOP 33 Zwischenbericht zum Fonds „#miteinander“
- TOP 34 Schlussbericht des Ausschusses für Diakonie
- TOP 35 Schlussbericht des Sonderausschusses für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte
- TOP 36 Abschluss der 16. Landessynode
- Gottesdienst mit Abendmahl in der Stiftskirche
Dokumente zu Tagesordnungspunkt 17
Landeskirche wappnet sich gegen Unterwanderung von Extremisten / Wer sich kirchenfeindlich betätigt, kann sein Wahlrecht verlieren

Die Landessynode hat dem vom Rechtsausschuss eingebrachten Antrag Nr. 09/25 „Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus“ und der Beilage 128 mit großer Mehrheit zugestimmt. Damit könnten Personen, die im Zusammenhang mit der Unterstützung kirchenfeindlicher Betätigungen stehen, künftig ihr Wahlrecht verlieren.
Professor Dr. Marin Plümicke, stellvertretender Vorsitzender des Rechtsausschusses stellte in seinem Bericht dar, wie der ursprüngliche Antrag Nr. 01/24 „Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus“ konkret weiterbearbeitet wurde. Nach der juristischen Prüfung habe der Oberkirchenrat den Ausschuss informiert, wie rechtlich komplex die Situation sei, da verschiedene Rechtsnormen auf unterschiedliche Fälle angewendet werden müssten. Anhand von fünf Kriterien müsse in jedem Einzelfall geprüft werden, so Plümicke, ob die betreffende Person als öffentlich auftretender Funktionsträger für eine vom Verfassungsschutz als „gesichert extremistische Bestrebung“ eingestufte Partei in Widerspruch zum Evangelium steht.
In der „Handreichung der Landeskirche für Pfarrer, Kirchengemeinderäte und Visitatoren zur Anwendung der Kirchlichen Wahlordnung“ gebe es bereits rechtliche Möglichkeiten, Personen mit rechtsextremistischen Einstellungen von kirchlichen Leitungsämtern auszuschließen. Der Oberkirchenrat präzisierte diese Regelungen weiter, um deren Anwendung zu erleichtern. Plümicke wies die Synodalen besonders auf den Passus in Beilage 128 hin, der den Verlust des Wahlrechts regelt, und brachte den Antrag Nr. 09/25 „Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus“ zur Abstimmung ein.
Aussprache
In der Aussprache gab es keine Wortmeldungen.
Beschluss
Die Synode hat dem Antrag Nr. 09/25 „Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus“ zusammen mit der Beilage 129 und damit der Änderung der Handreichung der Landeskirche für Pfarrer, Kirchengemeinderäte und Visitatoren zur Anwendung der Kirchlichen Wahlordnung ohne Aussprache bei einer Nein-Stimme mit großer Mehrheit zugestimmt.
Den vollständigen Bericht zu TOP 17 finden Sie in der Klappbox oben: Dokumente zu Tagesordnungspunkt 17
TOP 18 Bericht der Projektstelle für die Themen Rassismus und Antisemitismus/Populismus und Extremismus
Alle Themen der Tagung
⬆️ Zum Seitenanfang
✳️Landessynode kompakt: Die wichtigsten Themen im Überblick
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente:
- Grußworte
- Verabschiedung der Unabhängigen Kommission zur Gewährung von Leistungen in Anerkennung des Leids Betroffener sexualisierter Gewalt und Verleihung der Silbernen Brenz-Medaille an den Vorsitzenden Wolfgang Vögele
- TOP 01 Strategische Planung
- TOP 02 Planüberschreitungen und Jahresabschluss der landeskirchlichen Rechnung 2024
TOP 03 1. Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 mit Kirchlichem Gesetz - TOP 04 Trauung gleichgeschlechtlich liebender Ehepaare
- TOP 05
- TOP 06 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung und des Gottesdienstes anlässlich der Eheschließung (Beilage 145)
- TOP 07 Kirchliches Gesetz zur Ablösung des Diakonen- und Diakoninnengesetzes und zur Änderung des Württ. Pfarrergesetzes (Beilage 141)
- TOP 08 Kirchliches Gesetz zur Änderung von Dienstverpflichtungen (Beilage 140)
- TOP 09 Gottesdienstbuch für die Ev. Landeskirche in Württemberg, Zweiter Teil, Teilband Einführungen und Verabschiedungen
- TOP 10 Bericht über die Situation der verfolgten Christen in der Welt sowie der Menschen, die aus religiösen, rassistischen, politischen, ethnischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gründen unter Verfolgung leiden – Schwerpunkt auf Syrien, Kolumbien, Nigeria und Pakistan
- TOP 11 Berichte des Beauftragten für die Entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs und des Islambeauftragten
- TOP 12 Aktuelle Stunde
- TOP 13 Schlussbericht des Ausschusses für Mission, Ökumene und Entwicklung
- TOP 14 Schlussbericht des Finanzausschusses
- TOP 15 Schlussbericht des Ausschusses für Bildung und Jugend
- TOP 16 Änderung des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes
- TOP 17 Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 18 Bericht der Projektstelle für die Themen Rassismus und Antisemitismus/Populismus und Extremismus
- Bildergalerie:Impressionen der Herbsttagung
- TOP 19 Abschaffung der Aktuellen Stunde
- TOP 20 OIKOS und die AKSB
- TOP 21 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (Beilage 142)
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (144)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Kirchengemeindeordnung und weiterer Regelungen (Beilage 143)
- TOP 24 Schlussbericht des Rechtsausschusses
- TOP 25 Selbständige Anträge
- TOP 26 Förmliche Anfragen
- TOP 27 Schlussbericht des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung
- TOP 28 Schlussbericht des Theologischen Ausschusses
- TOP 29 Abschlussbericht des Projekts „Geistlich Leiten, vom Geist geleitet“
- TOP 30 Schlussbericht des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung
- TOP 31 „Raum geben“ - Zwischenbericht zu den Projekten „Aufbruch Quartier“ und „Aufbruch Wohnen“
- TOP 32 Abschlussbericht des Projekts „Zukunftsgutscheine”
- TOP 33 Zwischenbericht zum Fonds „#miteinander“
- TOP 34 Schlussbericht des Ausschusses für Diakonie
- TOP 35 Schlussbericht des Sonderausschusses für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte
- TOP 36 Abschluss der 16. Landessynode
- Gottesdienst mit Abendmahl in der Stiftskirche
Dokumente zu Tagesordnungspunkt 18
Auf dem Weg zu einer rassismus- und antisemitismuskritischen Kirche - Schlussbilanz der Projektstelle

Agnes Kübler, Referentin für die Themen Rassismus und Antisemitismus, stellte auf der Herbstsynode ihren Abschlussbericht über die bereits am 31. Oktober 2022 ausgelaufene Projektstelle für Populismus und Extremismus sowie die am 31. Oktober 2025 auslaufende Projektstelle Rassismus und Antisemitismus vor. Als Referentin sei es ihre Aufgabe gewesen, „auf dem Weg zur rassismus- und antisemitismuskritischen Kirche einen (Ver-)Lernprozess anzustoßen und Veränderungen zu begleiten“. Dabei erwähnte sie auch, welch eminent großen Einfluss die Corona-Pandemie mit ihren Folgen auf ihre Arbeit hatte. Die große Nachfrage nach ihren Workshops belege die „Notwendigkeit einer verlässlichen Anlaufstelle, die innerkirchliche Perspektive mit fachlicher Kompetenz verbindet“, so Kübler. In Zukunft werde die Fach- und Beratungsstelle für Weltanschauungsfragen für die Themen Populismus und Extremismus und für das Thema Antisemitismus das Pfarramt für das Gespräch zwischen Christen und Juden zuständig sein, während das Thema Rassismus/Rassismuskritik kontinuierlich Gegenstand der Bildungsprogramme bleiben dürfte.
Den vollständigen Bericht zu TOP 18 finden Sie in der Klappbox oben: Dokumente zu Tagesordnungspunkt 18
TOP 19 Abschaffung der Aktuellen Stunde
Alle Themen der Tagung
⬆️ Zum Seitenanfang
✳️Landessynode kompakt: Die wichtigsten Themen im Überblick
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente:
- Grußworte
- Verabschiedung der Unabhängigen Kommission zur Gewährung von Leistungen in Anerkennung des Leids Betroffener sexualisierter Gewalt und Verleihung der Silbernen Brenz-Medaille an den Vorsitzenden Wolfgang Vögele
- TOP 01 Strategische Planung
- TOP 02 Planüberschreitungen und Jahresabschluss der landeskirchlichen Rechnung 2024
TOP 03 1. Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 mit Kirchlichem Gesetz - TOP 04 Trauung gleichgeschlechtlich liebender Ehepaare
- TOP 05
- TOP 06 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung und des Gottesdienstes anlässlich der Eheschließung (Beilage 145)
- TOP 07 Kirchliches Gesetz zur Ablösung des Diakonen- und Diakoninnengesetzes und zur Änderung des Württ. Pfarrergesetzes (Beilage 141)
- TOP 08 Kirchliches Gesetz zur Änderung von Dienstverpflichtungen (Beilage 140)
- TOP 09 Gottesdienstbuch für die Ev. Landeskirche in Württemberg, Zweiter Teil, Teilband Einführungen und Verabschiedungen
- TOP 10 Bericht über die Situation der verfolgten Christen in der Welt sowie der Menschen, die aus religiösen, rassistischen, politischen, ethnischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gründen unter Verfolgung leiden – Schwerpunkt auf Syrien, Kolumbien, Nigeria und Pakistan
- TOP 11 Berichte des Beauftragten für die Entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs und des Islambeauftragten
- TOP 12 Aktuelle Stunde
- TOP 13 Schlussbericht des Ausschusses für Mission, Ökumene und Entwicklung
- TOP 14 Schlussbericht des Finanzausschusses
- TOP 15 Schlussbericht des Ausschusses für Bildung und Jugend
- TOP 16 Änderung des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes
- TOP 17 Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 18 Bericht der Projektstelle für die Themen Rassismus und Antisemitismus/Populismus und Extremismus
- Bildergalerie:Impressionen der Herbsttagung
- TOP 19 Abschaffung der Aktuellen Stunde
- TOP 20 OIKOS und die AKSB
- TOP 21 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (Beilage 142)
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (144)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Kirchengemeindeordnung und weiterer Regelungen (Beilage 143)
- TOP 24 Schlussbericht des Rechtsausschusses
- TOP 25 Selbständige Anträge
- TOP 26 Förmliche Anfragen
- TOP 27 Schlussbericht des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung
- TOP 28 Schlussbericht des Theologischen Ausschusses
- TOP 29 Abschlussbericht des Projekts „Geistlich Leiten, vom Geist geleitet“
- TOP 30 Schlussbericht des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung
- TOP 31 „Raum geben“ - Zwischenbericht zu den Projekten „Aufbruch Quartier“ und „Aufbruch Wohnen“
- TOP 32 Abschlussbericht des Projekts „Zukunftsgutscheine”
- TOP 33 Zwischenbericht zum Fonds „#miteinander“
- TOP 34 Schlussbericht des Ausschusses für Diakonie
- TOP 35 Schlussbericht des Sonderausschusses für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte
- TOP 36 Abschluss der 16. Landessynode
- Gottesdienst mit Abendmahl in der Stiftskirche
Aktuelle Stunde bei Synodaltagungen nur noch optional
Die Landessynode hat beschlossen, dass die sogenannte Aktuelle Stunde künftig nicht mehr zum Standard der Tagesordnung gehört, sondern nur noch bei Bedarf genutzt wird, um aktuelle Themen aus Kirche und Gesellschaft zu diskutieren.

Christoph Müller, Vorsitzender des Rechtsausschusses, berichtete über Antrag Nr. 29/25 zur Änderung der Geschäftsordnung, mit dem die Aktuelle Stunde als regelmäßiger Tagesordnungspunkt für die Plenumstagungen abgeschafft wird. Grund sei, dass der Bedarf für diesen regelmäßigen TOP zurückgegangen sei. Zudem seien die Sitzungstage und die Sitzungszeit der Landessynode reduziert worden. Dazu passe eine regelmäßige Aktuelle Stunde, die nicht zu den Kernaufgaben einer Synode gehöre, nicht mehr.
Der Ältestenrat der Landessynode habe sich in einer Stellungnahme dafür ausgesprochen, dass die Aktuelle Stunde als Option bestehen bleibt. Über die Aufnahme in die Tagesordnung sowie das Thema solle der Präsident/die Präsidentin der Synode mit den Stellvertretenden im Einvernehmen mit dem Landesbischof entscheiden.
Der Rechtsausschuss empfehle der Synode diesen Beschluss, so Müller.
Aussprache
Christiane Mörk (Brackenheim) sagte, es sei wichtig, bei den Tagungen eine Stunde lang über die internen kirchlichen Themen hinauszudenken. Auch sei es wertvoll, in den Gesprächskreisen zu diskutieren, welches Thema besprochen werden könnte.
Michael Schradi (Blaubeuren) sagte, sich noch weniger zu Wort zu melden, sei ein Rückzug aus der Öffentlichkeit. Die Aktuelle Stunde sei für ihn immer ein Höhepunkt, bei dem die Vielfalt der Positionen sichtbar werde. Hier werde kein Blockdenken erkennbar. Man solle diesen Reichtum bewahren, auch um glaubwürdig die Gemeinden zur Vielfalt anhalten zu können. Stellungnahmen des Landesbischofs müssten durch Diskussion untermauert werden. Wenn Kirche sich Demokratieförderung auf die Fahnen schreibe, dann müsse sie auch in der Synode dem Diskurs Raum geben. So werde gesellschaftliche Teilhabe sichtbar. Diskussion stärke Gesellschaft und Kirche.
Gerhard Keitel (Maulbronn) erinnerte daran, dass Martin Luther seine Thesen nicht „smooth und wenig kritisch“ weitergegeben habe. Er plädierte dafür, die reformatorische Streitkultur zu erhalten und „diesen reformatorischen Schatz nicht aus der Hand zu geben“.
Eckart Schultz-Berg (Stuttgart) sagte, er fürchte, die Aktuelle Stunde könne immer häufiger entfallen, wenn sie von der Pflicht zur Kür werde. Er schlug vor, umgekehrt vorzugehen, dass die Aktuelle Stunde jeweils nur durch Beschluss der Synode entfallen könne.
Christoph Hillebrand (Dettingen am Albuch) betonte, wichtige Themen gehörten gut vorbereitet auf die Tagesordnung.
Renate Simpfendörfer (Eislingen) sagte, es müsse weiter die Möglichkeit der Aktuellen Stunde geben, weil „wir hier eine Verbindung zwischen Kirche und Gesellschaft herstellen und Stellung beziehen können und müssen“. Ein gutes Beispiel sei die „abgesagte Aktuelle Stunde heute. Noch aktueller als die Diskussion über das Stadtbild in Deutschland kann kein Anlass sein“. Hier hätte die Synode ihr christliches Selbstverständnis zeigen können. Die Synode dürfe sich nicht nur in der kirchlichen Blase bewegen. Was in der Gesellschaft passiere, habe auch mit der Synode zu tun. Nicht auf aktuelle Ereignisse zu reagieren, bedeute, die Augen zu verschließen.
Dr. Christoph Lehmann (Rietheim-Weilheim) sagte, er habe mit politischen Äußerungen der Kirche Probleme, denn Gewissheit habe er nur bezüglich des Evangeliums, nicht aber in politischen Fragen. Gerade deshalb sei die Aktuelle Stunde wichtig, denn hier kämen sehr unterschiedliche Herangehensweisen zu Wort. Die Aktuelle Stunde sei für ihn die „klügste Form politischer Stellungnahme der Kirche“.
Beschluss
Die Synode hat Antrag 29/25 mit Mehrheit angenommen.
Den vollständigen Bericht zu TOP 19 finden Sie in der Klappbox oben: Dokumente zu Tagesordnungspunkt 19
TOP 20 OIKOS und die AKSB
Alle Themen der Tagung
⬆️ Zum Seitenanfang
✳️Landessynode kompakt: Die wichtigsten Themen im Überblick
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente:
- Grußworte
- Verabschiedung der Unabhängigen Kommission zur Gewährung von Leistungen in Anerkennung des Leids Betroffener sexualisierter Gewalt und Verleihung der Silbernen Brenz-Medaille an den Vorsitzenden Wolfgang Vögele
- TOP 01 Strategische Planung
- TOP 02 Planüberschreitungen und Jahresabschluss der landeskirchlichen Rechnung 2024
TOP 03 1. Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 mit Kirchlichem Gesetz - TOP 04 Trauung gleichgeschlechtlich liebender Ehepaare
- TOP 05
- TOP 06 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung und des Gottesdienstes anlässlich der Eheschließung (Beilage 145)
- TOP 07 Kirchliches Gesetz zur Ablösung des Diakonen- und Diakoninnengesetzes und zur Änderung des Württ. Pfarrergesetzes (Beilage 141)
- TOP 08 Kirchliches Gesetz zur Änderung von Dienstverpflichtungen (Beilage 140)
- TOP 09 Gottesdienstbuch für die Ev. Landeskirche in Württemberg, Zweiter Teil, Teilband Einführungen und Verabschiedungen
- TOP 10 Bericht über die Situation der verfolgten Christen in der Welt sowie der Menschen, die aus religiösen, rassistischen, politischen, ethnischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gründen unter Verfolgung leiden – Schwerpunkt auf Syrien, Kolumbien, Nigeria und Pakistan
- TOP 11 Berichte des Beauftragten für die Entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs und des Islambeauftragten
- TOP 12 Aktuelle Stunde
- TOP 13 Schlussbericht des Ausschusses für Mission, Ökumene und Entwicklung
- TOP 14 Schlussbericht des Finanzausschusses
- TOP 15 Schlussbericht des Ausschusses für Bildung und Jugend
- TOP 16 Änderung des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes
- TOP 17 Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 18 Bericht der Projektstelle für die Themen Rassismus und Antisemitismus/Populismus und Extremismus
- Bildergalerie:Impressionen der Herbsttagung
- TOP 19 Abschaffung der Aktuellen Stunde
- TOP 20 OIKOS und die AKSB
- TOP 21 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (Beilage 142)
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (144)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Kirchengemeindeordnung und weiterer Regelungen (Beilage 143)
- TOP 24 Schlussbericht des Rechtsausschusses
- TOP 25 Selbständige Anträge
- TOP 26 Förmliche Anfragen
- TOP 27 Schlussbericht des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung
- TOP 28 Schlussbericht des Theologischen Ausschusses
- TOP 29 Abschlussbericht des Projekts „Geistlich Leiten, vom Geist geleitet“
- TOP 30 Schlussbericht des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung
- TOP 31 „Raum geben“ - Zwischenbericht zu den Projekten „Aufbruch Quartier“ und „Aufbruch Wohnen“
- TOP 32 Abschlussbericht des Projekts „Zukunftsgutscheine”
- TOP 33 Zwischenbericht zum Fonds „#miteinander“
- TOP 34 Schlussbericht des Ausschusses für Diakonie
- TOP 35 Schlussbericht des Sonderausschusses für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte
- TOP 36 Abschluss der 16. Landessynode
- Gottesdienst mit Abendmahl in der Stiftskirche
Dokumente zu Tagesordnungspunkt 20
Antrag zur Verschiebung des Zieldatums für Netto-Treibhausneutralität

Das in den Allgemeinen Klimaschutzbestimmungen (AKSB) auf 2040 festgesetzte Zieldatum für die Netto-Treibhausneutralität solle auf 2045 verschoben werden. Begründet wird dies mit noch fehlenden Daten der OIKOS-Studie.
Der Rechtsausschuss habe zu diesem Thema, so Christoph Müller, Vorsitzender des Rechtsausschusses, Stellungnahmen des Finanzausschusses und des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung eingeholt. Beide Ausschüsse hätten sich gegen den Antrag ausgesprochen.
Auch der Oberkirchenrat habe empfohlen, das Datum nicht zu verändern. Er habe darauf hingewiesen, dass die Netto-Treibhausneutralität nicht für die Gebäude allein, sondern für die Landeskirche als ganze gälte. Zudem hätten die AKBS keinen Gewichtungsvorrang bei Entscheidungen.
Dennoch habe sich der Rechtsausschuss mit knapper Mehrheit entschieden, den Antrag weiterzuverfolgen und um Zustimmung zu bitten.
Aussprache
Ruth Bauer (Alfdorf) betonte, dass sie es für grundlegend falsch hielte, die Jahreszahl zu ändern. Das Gesetz wäre eben erst angelaufen. Sie verwies auf die strategische Planung, nach der die Landeskirche gut vorankäme. Eine Vermischung von Oikos und dem Klimaschutzgesetz müsse vermieden werden. Sie nannte weltweite, aber auch lokale Folgen des Klimawandels. Diese würden viel Leid verursachen. Zudem wäre die Bewahrung der Schöpfung für die Kirche zentral und dazu gehöre der Klimaschutz.
Anette Sawade (Schwäbisch Hall) berichtete von den intensiven Beratungen des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung. Dabei wäre nochmal deutlich geworden, dass Oikos und AKSB zwar zusammenwirkten, aber getrennt betrachtet werden müssten. Sie erinnerte daran, dass sich der Ausschuss gegen die Änderung ausgesprochen habe. Zudem gäbe es viele gute Ideen, die noch breiter kommuniziert werden könnten.
Eckart Schultz-Berg (Stuttgart) wies darauf hin, wie kurz das Gesetz erst gültig wäre und wie weit 2040 noch weg sei. Auch der Umweltrat der Landeskirche, dessen zweiter Vorsitzender er sei, empfehle, das Ziel nicht zu verschieben. Vielmehr solle die nächste Synode das Gesetz auf seine Machbarkeit prüfen und dabei neuste technische Entwicklungen mitdenken.
Dr. Markus Ehrmann (Rot am See) fügte hinzu, dass der Klimaschutz nicht als Druckmittel dienen dürfe, um Sparziele einzuhalten. Für eine Verschiebung des Zieles wäre es zu früh. Es gäbe noch nicht einmal Daten zu den Emissionen der Landeskirche als Ganzes. Sanierungsbedürftige Häuser zu verkaufen, um Klimaneutralität zu erreichen, empfände er als scheinheilig, die Emissionen entständen dabei ja weiter. Er sprach sich ebenfalls dafür aus, in einigen Jahren nochmal darüber zu diskutieren.
Auch Michael Schradi (Blaubeuren) sprach sich gegen eine Verschiebung aus. Man müsse sogar noch ambitionierter vorgehen, immerhin seien wir in der nördlichen Hemisphäre Hauptverursacher und andere Teile der Welt würden unter den Folgen leiden. Schradi betonte zudem, dass die Glaubwürdigkeit vor allem gegenüber jungen Menschen auf dem Spiel stünde, die ihre Zukunft von den Auswirkungen des Klimawandels bedroht sähen.
Dr. Thomas Gerold äußerte große Sorge um seine Gemeinde. Diese sei sehr aktiv, aber die Gebäude seien schwer bis gar nicht sanierbar und fürchten ihre Schließung. Ohne Auto sei dann keine Teilnahme an Gottesdienst und Gemeindeleben mehr möglich. Dies müsse verhindert werden. Dafür sei auch die klare Trennung zwischen Oikos und Klimaschutz wichtig, aber eben auch ein realistisches Ziel.
Christiane Mörk (Brackenheim) stellte vor dem Hintergrund der diesjährigen Aktion Brot für die Welt zum Thema „Kraft zum Leben schöpfen“ die Folgen der Klimakrise heraus. Diese seien in Form von Unwetter, Wassermangel und Hunger im globalen Süden bereits dramatisch.
Michael Schneider (Balingen) hatte den Antrag eingebracht. Er danke für die Klärungen und verstehe das Problem der Vermischung von Oikos und Klimaschutzbestimmungen. Er sehe die Betonung der eingeschränkten Bindungswirkung und der Möglichkeit, das Ziel auch zu verpassen, sehr kritisch. Er fürchte eine „dann ist auch nicht schlimm“ und „andere Kirchenbezirke können das ja ausgleichen“ Haltung in den Kirchenbezirken, bei denen die Sanierung der Gebäude schwierig sei. Eine Verschiebung würde das Ziel nicht weniger wichtig machen, so Schneider, sondern Zeit geben, es gut umzusetzen. Auch der Bund hätte 2045 als Ziel gewählt.
Rainer Köpf (Backnang) unterstützte Michael Schneider und fügte hinzu, dass Immobilienplanung schon ohne Oikos viel Zeit benötigt habe, da mit Kommunen verhandelt und Bauanträge gestellt werden müssten. Er fürchte zudem Schließungen von Kirchen im Winter, die auf dem Land jedoch wichtige Orte für Kunst und Kultur sein. Köpfe fragte an, welche juristischen Folgen ein Verfehlen des Zieles für die Amtsträger 2040 haben werde.
Holger Stähle (Schwäbisch Hall) brachte ein Beispiel, für eine gelungene Sanierung ein. Ihm sei bewusst, dass dies nicht überall möglich sei. Deswegen sei das Ziel für die ganze Landeskirche gesetzt.
Renate Simpfendörfer (Eislingen) zog eine Parallele zwischen den finanziellen Sparmaßnahmen der letzten Jahre und dem Klimaschutz. In beiden Fällen ginge es darum, die Lasten nicht auf die nächsten Generationen zu verschieben. Dazu sei es eben vielleicht nötig, im Winter andere Räume zu nutzen oder mit Decken im Gottesdienst zu sitzen.
In einem Zwischenruf stellte Andrea Bleher (Untermünkheim) klar, dass es nicht um die Aufgabe des Klimaschutzes ginge, sondern um Realismus bei der Zielsetzung.
Simpfendörfer reagierte darauf mit einer Hoffnung für die Zukunft: „Ich hoffe, dass wir bis 2040 unsere Klimaschutzziele erreichen, damit ich dann noch in den Gottesdienst gehen kann. In einem klimaschutzsanierten Gemeindehaus im Winter. Und im Sommer in die kühle Kirche.“
Oberkirchenrat Dr. Michael Frisch (Dezernat Recht) fasste nochmal einige Argumente zusammen. Dabei zitierte er aus den allgemeinen Klimaschutzbestimmungen. Auf die Kritik der Antragsteller, dass durch Oikos und die Bestimmungen Zeit und Geld fehlen, betonte er das Ziel des Oikos-Prozesses. Dieses sei, die vorhandenen Mittel sinnvoll zu verteilen und vor Fehlinvestitionen zu schützen.
Mehrfach betonte Frisch, dass eben nicht jedes Gebäude treibhausneutral werden müsse und die Klimaschutzbestimmungen nicht zur Aufgabe dieser Immobilien zwingen würde. Zusätzlich zeigte er die mögliche negative Außenwirkung einer Verschiebung auf. Noch blieben 15 Jahre. Dass jetzt schon ein solcher Druck durch die Anpassung spürbar sei, solle nicht zu einem Ändern der Ziele, sondern zu einer besseren Unterstützung der Kirchengemeinden und Kirchenbezirke bei der Umsetzung führen.
Beschluss
Der Antrag Nr. 24/25 wurde mit deutlicher Mehrheit abgelehnt.
Den vollständigen Bericht zu TOP 20 finden Sie in der Klappbox oben: Dokumente zu Tagesordnungspunkt 20
TOP 21 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (Beilage 142)
Alle Themen der Tagung
⬆️ Zum Seitenanfang
✳️Landessynode kompakt: Die wichtigsten Themen im Überblick
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente:
- Grußworte
- Verabschiedung der Unabhängigen Kommission zur Gewährung von Leistungen in Anerkennung des Leids Betroffener sexualisierter Gewalt und Verleihung der Silbernen Brenz-Medaille an den Vorsitzenden Wolfgang Vögele
- TOP 01 Strategische Planung
- TOP 02 Planüberschreitungen und Jahresabschluss der landeskirchlichen Rechnung 2024
TOP 03 1. Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 mit Kirchlichem Gesetz - TOP 04 Trauung gleichgeschlechtlich liebender Ehepaare
- TOP 05
- TOP 06 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung und des Gottesdienstes anlässlich der Eheschließung (Beilage 145)
- TOP 07 Kirchliches Gesetz zur Ablösung des Diakonen- und Diakoninnengesetzes und zur Änderung des Württ. Pfarrergesetzes (Beilage 141)
- TOP 08 Kirchliches Gesetz zur Änderung von Dienstverpflichtungen (Beilage 140)
- TOP 09 Gottesdienstbuch für die Ev. Landeskirche in Württemberg, Zweiter Teil, Teilband Einführungen und Verabschiedungen
- TOP 10 Bericht über die Situation der verfolgten Christen in der Welt sowie der Menschen, die aus religiösen, rassistischen, politischen, ethnischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gründen unter Verfolgung leiden – Schwerpunkt auf Syrien, Kolumbien, Nigeria und Pakistan
- TOP 11 Berichte des Beauftragten für die Entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs und des Islambeauftragten
- TOP 12 Aktuelle Stunde
- TOP 13 Schlussbericht des Ausschusses für Mission, Ökumene und Entwicklung
- TOP 14 Schlussbericht des Finanzausschusses
- TOP 15 Schlussbericht des Ausschusses für Bildung und Jugend
- TOP 16 Änderung des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes
- TOP 17 Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 18 Bericht der Projektstelle für die Themen Rassismus und Antisemitismus/Populismus und Extremismus
- Bildergalerie:Impressionen der Herbsttagung
- TOP 19 Abschaffung der Aktuellen Stunde
- TOP 20 OIKOS und die AKSB
- TOP 21 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (Beilage 142)
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (144)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Kirchengemeindeordnung und weiterer Regelungen (Beilage 143)
- TOP 24 Schlussbericht des Rechtsausschusses
- TOP 25 Selbständige Anträge
- TOP 26 Förmliche Anfragen
- TOP 27 Schlussbericht des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung
- TOP 28 Schlussbericht des Theologischen Ausschusses
- TOP 29 Abschlussbericht des Projekts „Geistlich Leiten, vom Geist geleitet“
- TOP 30 Schlussbericht des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung
- TOP 31 „Raum geben“ - Zwischenbericht zu den Projekten „Aufbruch Quartier“ und „Aufbruch Wohnen“
- TOP 32 Abschlussbericht des Projekts „Zukunftsgutscheine”
- TOP 33 Zwischenbericht zum Fonds „#miteinander“
- TOP 34 Schlussbericht des Ausschusses für Diakonie
- TOP 35 Schlussbericht des Sonderausschusses für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte
- TOP 36 Abschluss der 16. Landessynode
- Gottesdienst mit Abendmahl in der Stiftskirche
Mitarbeitervertretung: Änderungen bei Einigungsstellen und Freistellung

Das Mitarbeitervertretungsgesetz der Landeskirche soll geändert werden; wichtige Punkte in den Beratungen des Rechtsausschusses waren u.a. die Einigungstellen und die Freistellungen der Mitglieder der Mitarbeitervertretung.
Der Vorsitzende des Rechtsausschusses, Christoph Müller, berichtete von der Behandlung des Gesetzesentwurfs im Ausschuss. Strittige Punkte seien zum einen die Einigungstellen gewesen. Der Entwurf des Oberkirchenrats sehe für den Bereich der LAKIMAV* und der AGMAV** jeweils eine zentrale Stelle vor, da betriebliche Stellen nicht zielführend und kostenintensiver seien. Im Rechtsausschuss habe es einerseits Zustimmung zum Aspekt der Kosten für kleinere Träger gegeben, andererseits erwarte man eine bessere Lösung der Probleme auf betrieblicher Ebene. Als Kompromiss schlage der Ausschuss eine zentrale Einigungsstelle für den Bereich der LAKIMAV vor, im Bereich der AGMAV könne durch Dienstvereinbarung eine betriebliche Einigungsstelle statt der zentralen geschaffen werden.
Zweiter umstrittener Punkt des Entwurfs sei die Freistellung für Mitglieder der Mitarbeitervertretung gewesen. Der Entwurf sehe eine neue Stufe bei 700 Mitarbeitern vor; dies sei dem Rechtsausschuss jedoch nicht ausreichend erschienen. Die Stellungnahmen der AGMAV und LAKIMAV hätten deutlich höhere Freistellungen bis zu einer Angleichung an das Betriebsverfassungsgesetz gefordert. Der Ausschuss habe weitere Zwischenstufen und einen leicht erhöhten Umfang vorgeschlagen.
Der Rechtsausschuss bat die Synode um Zustimmung zum hier vorgelegten Entwurf.
*Landeskirchliche Mitarbeitervertretung
** Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen im Diakonischen Werk Württemberg
Aussprache
Die Synodale Ulrike Sämann (Plochingen) betonte die Bedeutung des Mitarbeitervertretungsgesetzes, das wie das Betriebsverfassungsgesetz auf staatlicher Ebene eine wichtige Errungenschaft in der kirchlichen und diakonischen Arbeitswelt sei. Der Freistellungsanspruch sei bisher bei weitem nicht ausreichend und eine Anpassung unbedingt erforderlich gewesen. Sie selbst, angestellt bei der Diakonie Stetten, wisse aus vielen Gesprächen um das weite Feld an Zuständigkeiten einer MAV; dies benötige fundierte Kenntnisse und viel Zeit für Gespräche. Der Rechtsausschuss habe sich im vorliegenden Entwurf zu Erhöhungen in kleineren Stufen nach der Anzahl der Mitarbeitenden durchgerungen, als dies im Gesetzesentwurf des Oberkirchenrats vorgesehen gewesen sei. Dennoch stellten diese Zahlen nur einen Kompromiss dar.
Die Zahlen seien daher kein gutes Zeichen in einer Zeit, in der die Kirche und Diakonie in Konkurrenz zu anderen Arbeitgebern stünden. Ihr sei bewusst, dass mit höheren Freistellungen höhere Kosten verbunden seien. Sie werde dem Entwurf zustimmen, hoffe aber, dass die 17. Landessynode erneut dem Thema widme und dann höhere Freistellungen möglich seien.
Der Synodale Prof. Dr. Thomas Hörnig erklärte, dass die Menschen, die in der Diakonie arbeiteten, für viele eine glaubwürdige Außenseite der Kirche darstellten. Er werde dem Gesetz schweren Herzens zustimmen, obwohl es hinter dem Recht der EKD und der Caritas zurückbleibe. Den MAV, die für den Betriebsfrieden so wichtig seien, würden Rechte vorenthalten. Abschließend bedankte er sich bei den MAV für ihre unglaublich gute Arbeit, und äußerte ebenfalls die Hoffnung, das Thema in der nächsten Synode wieder aufzunehmen.
Die Synodale Anette Rösch (Wannweil) dankte zunächst allen Mitarbeitenden in den Diakonischen Werken für ihre Arbeit. Sie erläuterte, dass sie beide Seiten, die der Mitarbeitenden und die der Arbeitgeber kenne. Als Mitglied des Rechtsausschusses bedankte sie sich für die Stellungnahmen der MAV. Der vorliegende Entwurf sei ein Kompromiss, aber er sei ausgewogen und gut; sie empfehle die Zustimmung.
Beschluss
Der Gesetzesentwurf wurde in 1. und 2. Lesung verabschiedet.
Den vollständigen Bericht zu TOP 21 finden Sie in der Klappbox oben: Dokumente zu Tagesordnungspunkt 21
TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (Beilage 144)
Alle Themen der Tagung
⬆️ Zum Seitenanfang
✳️Landessynode kompakt: Die wichtigsten Themen im Überblick
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente:
- Grußworte
- Verabschiedung der Unabhängigen Kommission zur Gewährung von Leistungen in Anerkennung des Leids Betroffener sexualisierter Gewalt und Verleihung der Silbernen Brenz-Medaille an den Vorsitzenden Wolfgang Vögele
- TOP 01 Strategische Planung
- TOP 02 Planüberschreitungen und Jahresabschluss der landeskirchlichen Rechnung 2024
TOP 03 1. Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 mit Kirchlichem Gesetz - TOP 04 Trauung gleichgeschlechtlich liebender Ehepaare
- TOP 05
- TOP 06 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung und des Gottesdienstes anlässlich der Eheschließung (Beilage 145)
- TOP 07 Kirchliches Gesetz zur Ablösung des Diakonen- und Diakoninnengesetzes und zur Änderung des Württ. Pfarrergesetzes (Beilage 141)
- TOP 08 Kirchliches Gesetz zur Änderung von Dienstverpflichtungen (Beilage 140)
- TOP 09 Gottesdienstbuch für die Ev. Landeskirche in Württemberg, Zweiter Teil, Teilband Einführungen und Verabschiedungen
- TOP 10 Bericht über die Situation der verfolgten Christen in der Welt sowie der Menschen, die aus religiösen, rassistischen, politischen, ethnischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gründen unter Verfolgung leiden – Schwerpunkt auf Syrien, Kolumbien, Nigeria und Pakistan
- TOP 11 Berichte des Beauftragten für die Entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs und des Islambeauftragten
- TOP 12 Aktuelle Stunde
- TOP 13 Schlussbericht des Ausschusses für Mission, Ökumene und Entwicklung
- TOP 14 Schlussbericht des Finanzausschusses
- TOP 15 Schlussbericht des Ausschusses für Bildung und Jugend
- TOP 16 Änderung des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes
- TOP 17 Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 18 Bericht der Projektstelle für die Themen Rassismus und Antisemitismus/Populismus und Extremismus
- Bildergalerie:Impressionen der Herbsttagung
- TOP 19 Abschaffung der Aktuellen Stunde
- TOP 20 OIKOS und die AKSB
- TOP 21 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (Beilage 142)
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (144)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Kirchengemeindeordnung und weiterer Regelungen (Beilage 143)
- TOP 24 Schlussbericht des Rechtsausschusses
- TOP 25 Selbständige Anträge
- TOP 26 Förmliche Anfragen
- TOP 27 Schlussbericht des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung
- TOP 28 Schlussbericht des Theologischen Ausschusses
- TOP 29 Abschlussbericht des Projekts „Geistlich Leiten, vom Geist geleitet“
- TOP 30 Schlussbericht des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung
- TOP 31 „Raum geben“ - Zwischenbericht zu den Projekten „Aufbruch Quartier“ und „Aufbruch Wohnen“
- TOP 32 Abschlussbericht des Projekts „Zukunftsgutscheine”
- TOP 33 Zwischenbericht zum Fonds „#miteinander“
- TOP 34 Schlussbericht des Ausschusses für Diakonie
- TOP 35 Schlussbericht des Sonderausschusses für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte
- TOP 36 Abschluss der 16. Landessynode
- Gottesdienst mit Abendmahl in der Stiftskirche
Strukturerprobungsgesetz wird verlängert

Die Landessynode hat dem Gesetzentwurf zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (Beilage 144) mit großer Mehrheit zugestimmt. Damit besteht eine rechtliche Grundlage, die es kleinen Kirchengemeinden ermöglicht, Leitung und Geschäftsführung ohne geschäftsführende Pfarrperson erproben zu können.
Professor Dr. Martin Plümicke, stellvertretender Vorsitzender des Rechtsausschusses berichtete über die Umsetzungsprobleme des bei der diesjährigen Frühjahrstagung beschlossenen Strukturerprobungsgesetzes (Antrag Nr. 15/23). Das Gesetz sah vor, dass bis zu zehn kleine Kirchengemeinden Leitung und Geschäftsführung ohne geschäftsführende Pfarrperson erproben können.
Da das vorherige Strukturerprobungsgesetz zum 31. Dezember 2023 ausgelaufen war, fehlt in der aktuellen Gesetzeslage jedoch generell die Möglichkeit, Erprobungen zuzulassen. Plümicke führte aus, dass der Oberkirchenrat die Verlängerung des Gesetzes zwar grundsätzlich begrüße, aber deutlich machte, dass eine mögliche Strukturerprobung immer im Rahmen der geltenden Gesetze und der Bestimmungen der EKD durchgeführt werden müssten.
Der Oberkirchenrat plädierte für eine Laufzeit des Gesetzes von höchstens sechs Jahren, mit einer Verlängerungsoption von drei Jahren. Das Gesetz solle am 1. Januar 2026 in Kraft treten. Ein entsprechender Entwurf zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes wurde dem Rechtsauschuss vorgelegt, der einstimmig angenommen wurde. Plümicke empfahl den Synodalen, dieser neu eingebrachten Beilage 144 ebenfalls zuzustimmen.
Aussprache
Matthias Hanßmann (Horb am Neckar) unterstrich, dass eine Zustimmung zur Gesetzesvorlage völlig folgerichtig sei, da die Strukturerprobung nötig ist. Er hätte aber eine Laufzeit von sechs Jahren mit einer Verlängerungsoption von sechs Jahren eher für stimmig gehalten.
Der Antragsteller Prof. Dr. Martin Plümicke (Reutlingen) stellte klar, dass das Gesetz auf 6 Jahre begrenzt werden soll, aber eine Verlängerung um 3 Jahre möglich sei, es also um eine Laufzeit von insgesamt neun Jahren gehe. Er halte dies für eine hinreichend gute Erprobungszeit.
Beschluss
Der Gesetzentwurf zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (Beilage 144) wurde nach einer kurzen Aussprache bei einer Enthaltung mit großer Mehrheit verabschiedet.
Den vollständigen Bericht zu TOP 22 finden Sie in der Klappbox oben: Dokumente zu Tagesordnungspunkt 22
TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Kirchengemeindeordnung und weiterer Regelungen (Beilage 143)
Alle Themen der Tagung
⬆️ Zum Seitenanfang
✳️Landessynode kompakt: Die wichtigsten Themen im Überblick
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente:
- Grußworte
- Verabschiedung der Unabhängigen Kommission zur Gewährung von Leistungen in Anerkennung des Leids Betroffener sexualisierter Gewalt und Verleihung der Silbernen Brenz-Medaille an den Vorsitzenden Wolfgang Vögele
- TOP 01 Strategische Planung
- TOP 02 Planüberschreitungen und Jahresabschluss der landeskirchlichen Rechnung 2024
TOP 03 1. Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 mit Kirchlichem Gesetz - TOP 04 Trauung gleichgeschlechtlich liebender Ehepaare
- TOP 05
- TOP 06 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung und des Gottesdienstes anlässlich der Eheschließung (Beilage 145)
- TOP 07 Kirchliches Gesetz zur Ablösung des Diakonen- und Diakoninnengesetzes und zur Änderung des Württ. Pfarrergesetzes (Beilage 141)
- TOP 08 Kirchliches Gesetz zur Änderung von Dienstverpflichtungen (Beilage 140)
- TOP 09 Gottesdienstbuch für die Ev. Landeskirche in Württemberg, Zweiter Teil, Teilband Einführungen und Verabschiedungen
- TOP 10 Bericht über die Situation der verfolgten Christen in der Welt sowie der Menschen, die aus religiösen, rassistischen, politischen, ethnischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gründen unter Verfolgung leiden – Schwerpunkt auf Syrien, Kolumbien, Nigeria und Pakistan
- TOP 11 Berichte des Beauftragten für die Entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs und des Islambeauftragten
- TOP 12 Aktuelle Stunde
- TOP 13 Schlussbericht des Ausschusses für Mission, Ökumene und Entwicklung
- TOP 14 Schlussbericht des Finanzausschusses
- TOP 15 Schlussbericht des Ausschusses für Bildung und Jugend
- TOP 16 Änderung des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes
- TOP 17 Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 18 Bericht der Projektstelle für die Themen Rassismus und Antisemitismus/Populismus und Extremismus
- Bildergalerie:Impressionen der Herbsttagung
- TOP 19 Abschaffung der Aktuellen Stunde
- TOP 20 OIKOS und die AKSB
- TOP 21 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (Beilage 142)
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (144)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Kirchengemeindeordnung und weiterer Regelungen (Beilage 143)
- TOP 24 Schlussbericht des Rechtsausschusses
- TOP 25 Selbständige Anträge
- TOP 26 Förmliche Anfragen
- TOP 27 Schlussbericht des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung
- TOP 28 Schlussbericht des Theologischen Ausschusses
- TOP 29 Abschlussbericht des Projekts „Geistlich Leiten, vom Geist geleitet“
- TOP 30 Schlussbericht des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung
- TOP 31 „Raum geben“ - Zwischenbericht zu den Projekten „Aufbruch Quartier“ und „Aufbruch Wohnen“
- TOP 32 Abschlussbericht des Projekts „Zukunftsgutscheine”
- TOP 33 Zwischenbericht zum Fonds „#miteinander“
- TOP 34 Schlussbericht des Ausschusses für Diakonie
- TOP 35 Schlussbericht des Sonderausschusses für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte
- TOP 36 Abschluss der 16. Landessynode
- Gottesdienst mit Abendmahl in der Stiftskirche
Dokumente zu Tagesordnungspunkt 23
Künftig können beide Vorsitzenden des Kirchengemeinderats gewählte Mitglieder sein
Bislang wählten Kirchengemeinderäte (KGR) ihre 1. Vorsitzenden aus dem Kreis der gewählten oder zugewählten Mitglieder, während der 2. Vorsitz von der geschäftsführenden Pfarrperson bekleidet wurde. Nun können in Ausnahmefällen auch beide Vorsitze mit gewählten/zugewählten KGR-Mitgliedern besetzt werden.

Prof. Dr. Martin Plümicke, stellvertretender Vorsitzender des Rechtsausschusses, erklärte in seinem Bericht, der vorgelegte Gesetzentwurf gehe auf Antrag Nr. 26/23 zurück, mit dessen Beschluss die Frühjahrssynode 2025 den Oberkirchenrat gebeten habe, „die Möglichkeit zu schaffen, dass sowohl der 1. als auch der 2. Vorsitz im Kirchengemeinderat von gewählten bzw. zugewählten Mitgliedern wahrgenommen werden kann“.
Im Anschluss sei der Entwurf im Dialog zwischen Oberkirchenrat Dr. Michael Frisch (Leiter des Rechtsdezernats) und den Antragstellern so weiterentwickelt worden, dass das geschäftsführende Pfarramt erhalten bleibe, auch wenn beide Vorsitze von gewählten bzw. zugewählten Mitgliedern wahrgenommen werden. Diese Fassung sei dann im Rechtsausschuss unter Beteiligung des Ausschusses für Kirchen und Gemeindeentwicklung beraten und weiterentwickelt worden.
Kernpunkte des nun zum Beschluss vorgelegten Entwurfs:
- Im Ausnahmefall können beide Vorsitze des KGR von gewählten und zugewählten Mitgliedern geführt werden.
- Die Regel bleibt, dass die geschäftsführende Pfarrperson den 2. Vorsitz hat, nach Beschluss des KGR aber auch den 1. Vorsitz übernehmen kann.
- Die bisherige Verbindung von geschäftsführendem Pfarramt mit einem der beiden Vorsitze wird ersetzt durch eine explizite Festlegung des geschäftsführenden Pfarramts.
- Falls niemand gewählt wird, ist weiterhin die geschäftsführende Pfarrperson verantwortlich.
Aussprache
In der Aussprache gab es keine Wortmeldungen.
Beschluss
Das Kirchliche Gesetz zur Änderung der Kirchengemeindeordnung und weiterer Regelungen (Beilage 143) wurde von der Synode in erster Lesung ohne Wortmeldung verabschiedet und in zweiter Lesung mit großer Mehrheit verabschiedet.
Den vollständigen Bericht zu TOP 23 finden Sie in der Klappbox oben: Dokumente zu Tagesordnungspunkt 23
TOP 24 Schlussbericht des Rechtsausschusses
Alle Themen der Tagung
⬆️ Zum Seitenanfang
✳️Landessynode kompakt: Die wichtigsten Themen im Überblick
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente:
- Grußworte
- Verabschiedung der Unabhängigen Kommission zur Gewährung von Leistungen in Anerkennung des Leids Betroffener sexualisierter Gewalt und Verleihung der Silbernen Brenz-Medaille an den Vorsitzenden Wolfgang Vögele
- TOP 01 Strategische Planung
- TOP 02 Planüberschreitungen und Jahresabschluss der landeskirchlichen Rechnung 2024
TOP 03 1. Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 mit Kirchlichem Gesetz - TOP 04 Trauung gleichgeschlechtlich liebender Ehepaare
- TOP 05
- TOP 06 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung und des Gottesdienstes anlässlich der Eheschließung (Beilage 145)
- TOP 07 Kirchliches Gesetz zur Ablösung des Diakonen- und Diakoninnengesetzes und zur Änderung des Württ. Pfarrergesetzes (Beilage 141)
- TOP 08 Kirchliches Gesetz zur Änderung von Dienstverpflichtungen (Beilage 140)
- TOP 09 Gottesdienstbuch für die Ev. Landeskirche in Württemberg, Zweiter Teil, Teilband Einführungen und Verabschiedungen
- TOP 10 Bericht über die Situation der verfolgten Christen in der Welt sowie der Menschen, die aus religiösen, rassistischen, politischen, ethnischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gründen unter Verfolgung leiden – Schwerpunkt auf Syrien, Kolumbien, Nigeria und Pakistan
- TOP 11 Berichte des Beauftragten für die Entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs und des Islambeauftragten
- TOP 12 Aktuelle Stunde
- TOP 13 Schlussbericht des Ausschusses für Mission, Ökumene und Entwicklung
- TOP 14 Schlussbericht des Finanzausschusses
- TOP 15 Schlussbericht des Ausschusses für Bildung und Jugend
- TOP 16 Änderung des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes
- TOP 17 Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 18 Bericht der Projektstelle für die Themen Rassismus und Antisemitismus/Populismus und Extremismus
- Bildergalerie:Impressionen der Herbsttagung
- TOP 19 Abschaffung der Aktuellen Stunde
- TOP 20 OIKOS und die AKSB
- TOP 21 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (Beilage 142)
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (144)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Kirchengemeindeordnung und weiterer Regelungen (Beilage 143)
- TOP 24 Schlussbericht des Rechtsausschusses
- TOP 25 Selbständige Anträge
- TOP 26 Förmliche Anfragen
- TOP 27 Schlussbericht des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung
- TOP 28 Schlussbericht des Theologischen Ausschusses
- TOP 29 Abschlussbericht des Projekts „Geistlich Leiten, vom Geist geleitet“
- TOP 30 Schlussbericht des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung
- TOP 31 „Raum geben“ - Zwischenbericht zu den Projekten „Aufbruch Quartier“ und „Aufbruch Wohnen“
- TOP 32 Abschlussbericht des Projekts „Zukunftsgutscheine”
- TOP 33 Zwischenbericht zum Fonds „#miteinander“
- TOP 34 Schlussbericht des Ausschusses für Diakonie
- TOP 35 Schlussbericht des Sonderausschusses für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte
- TOP 36 Abschluss der 16. Landessynode
- Gottesdienst mit Abendmahl in der Stiftskirche
Dokumente zu Tagesordnungspunkt 24
„Das kirchliche Recht ist ein großer Schatz“
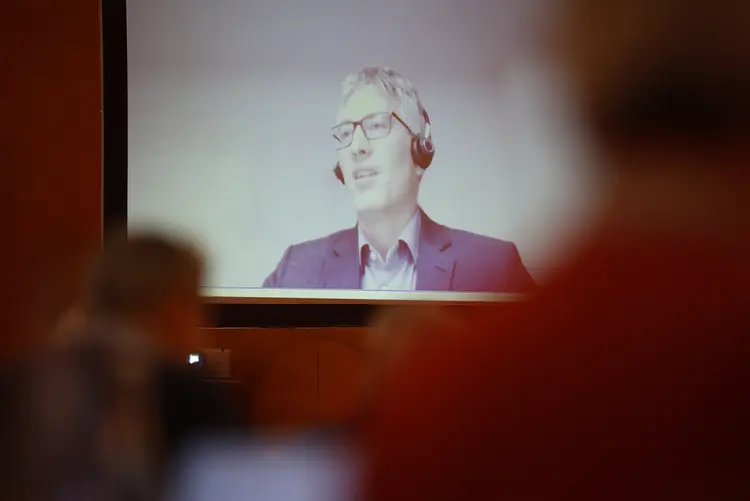
Christoph Müller, Vorsitzender des Rechtsausschusses, zeigte in seinem Schlussbericht auf, dass der Ausschuss in sechs Jahren eine außergewöhnlich hohe Anzahl von Anträgen und Beilagen bearbeitet habe, was zu einer hohen Belastung der ehrenamtlichen Kapazitäten geführt habe.
Inhaltlich standen vier große Themen im Fokus: Die Änderung des Kirchenverfassungsgesetzes, das Klimaschutzgesetz, die Verwaltungsmodernisierung und die Trauung gleichgeschlechtlicher Paare. Abschließend betonte er, dass das kirchliche Recht ein wertvoller, aber pflegebedürftiger Schatz sei, der künftig entschlackt und weiterentwickelt werden müsse, um dem Auftrag der Kirche gerecht zu bleiben.
Aussprache:
Der Zweiunterzeichner Kai Münzing (Dettingen an der Erms) fügte an, er bedauere die Entscheidung den Antrag 12/22 nicht weiter zu verfolgen, da das Ziel des Antrags war die Fachkräftesuche erheblich zu verbessern.
Den vollständigen Bericht zu TOP 24 finden Sie in der Klappbox oben: Dokumente zu Tagesordnungspunkt 24
TOP 25 Selbständige Anträge
Alle Themen der Tagung
⬆️ Zum Seitenanfang
✳️Landessynode kompakt: Die wichtigsten Themen im Überblick
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente:
- Grußworte
- Verabschiedung der Unabhängigen Kommission zur Gewährung von Leistungen in Anerkennung des Leids Betroffener sexualisierter Gewalt und Verleihung der Silbernen Brenz-Medaille an den Vorsitzenden Wolfgang Vögele
- TOP 01 Strategische Planung
- TOP 02 Planüberschreitungen und Jahresabschluss der landeskirchlichen Rechnung 2024
TOP 03 1. Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 mit Kirchlichem Gesetz - TOP 04 Trauung gleichgeschlechtlich liebender Ehepaare
- TOP 05
- TOP 06 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung und des Gottesdienstes anlässlich der Eheschließung (Beilage 145)
- TOP 07 Kirchliches Gesetz zur Ablösung des Diakonen- und Diakoninnengesetzes und zur Änderung des Württ. Pfarrergesetzes (Beilage 141)
- TOP 08 Kirchliches Gesetz zur Änderung von Dienstverpflichtungen (Beilage 140)
- TOP 09 Gottesdienstbuch für die Ev. Landeskirche in Württemberg, Zweiter Teil, Teilband Einführungen und Verabschiedungen
- TOP 10 Bericht über die Situation der verfolgten Christen in der Welt sowie der Menschen, die aus religiösen, rassistischen, politischen, ethnischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gründen unter Verfolgung leiden – Schwerpunkt auf Syrien, Kolumbien, Nigeria und Pakistan
- TOP 11 Berichte des Beauftragten für die Entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs und des Islambeauftragten
- TOP 12 Aktuelle Stunde
- TOP 13 Schlussbericht des Ausschusses für Mission, Ökumene und Entwicklung
- TOP 14 Schlussbericht des Finanzausschusses
- TOP 15 Schlussbericht des Ausschusses für Bildung und Jugend
- TOP 16 Änderung des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes
- TOP 17 Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 18 Bericht der Projektstelle für die Themen Rassismus und Antisemitismus/Populismus und Extremismus
- Bildergalerie:Impressionen der Herbsttagung
- TOP 19 Abschaffung der Aktuellen Stunde
- TOP 20 OIKOS und die AKSB
- TOP 21 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (Beilage 142)
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (144)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Kirchengemeindeordnung und weiterer Regelungen (Beilage 143)
- TOP 24 Schlussbericht des Rechtsausschusses
- TOP 25 Selbständige Anträge
- TOP 26 Förmliche Anfragen
- TOP 27 Schlussbericht des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung
- TOP 28 Schlussbericht des Theologischen Ausschusses
- TOP 29 Abschlussbericht des Projekts „Geistlich Leiten, vom Geist geleitet“
- TOP 30 Schlussbericht des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung
- TOP 31 „Raum geben“ - Zwischenbericht zu den Projekten „Aufbruch Quartier“ und „Aufbruch Wohnen“
- TOP 32 Abschlussbericht des Projekts „Zukunftsgutscheine”
- TOP 33 Zwischenbericht zum Fonds „#miteinander“
- TOP 34 Schlussbericht des Ausschusses für Diakonie
- TOP 35 Schlussbericht des Sonderausschusses für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte
- TOP 36 Abschluss der 16. Landessynode
- Gottesdienst mit Abendmahl in der Stiftskirche
Dokumente zu Tagesordnungspunkt 25
Es wurden keine Selbstständigen Anträge eingereicht.
Es wurden keine Selbstständigen Anträge eingereicht.
TOP 26 Förmliche Anfragen
Alle Themen der Tagung
⬆️ Zum Seitenanfang
✳️Landessynode kompakt: Die wichtigsten Themen im Überblick
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente:
- Grußworte
- Verabschiedung der Unabhängigen Kommission zur Gewährung von Leistungen in Anerkennung des Leids Betroffener sexualisierter Gewalt und Verleihung der Silbernen Brenz-Medaille an den Vorsitzenden Wolfgang Vögele
- TOP 01 Strategische Planung
- TOP 02 Planüberschreitungen und Jahresabschluss der landeskirchlichen Rechnung 2024
TOP 03 1. Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 mit Kirchlichem Gesetz - TOP 04 Trauung gleichgeschlechtlich liebender Ehepaare
- TOP 05
- TOP 06 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung und des Gottesdienstes anlässlich der Eheschließung (Beilage 145)
- TOP 07 Kirchliches Gesetz zur Ablösung des Diakonen- und Diakoninnengesetzes und zur Änderung des Württ. Pfarrergesetzes (Beilage 141)
- TOP 08 Kirchliches Gesetz zur Änderung von Dienstverpflichtungen (Beilage 140)
- TOP 09 Gottesdienstbuch für die Ev. Landeskirche in Württemberg, Zweiter Teil, Teilband Einführungen und Verabschiedungen
- TOP 10 Bericht über die Situation der verfolgten Christen in der Welt sowie der Menschen, die aus religiösen, rassistischen, politischen, ethnischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gründen unter Verfolgung leiden – Schwerpunkt auf Syrien, Kolumbien, Nigeria und Pakistan
- TOP 11 Berichte des Beauftragten für die Entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs und des Islambeauftragten
- TOP 12 Aktuelle Stunde
- TOP 13 Schlussbericht des Ausschusses für Mission, Ökumene und Entwicklung
- TOP 14 Schlussbericht des Finanzausschusses
- TOP 15 Schlussbericht des Ausschusses für Bildung und Jugend
- TOP 16 Änderung des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes
- TOP 17 Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 18 Bericht der Projektstelle für die Themen Rassismus und Antisemitismus/Populismus und Extremismus
- Bildergalerie:Impressionen der Herbsttagung
- TOP 19 Abschaffung der Aktuellen Stunde
- TOP 20 OIKOS und die AKSB
- TOP 21 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (Beilage 142)
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (144)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Kirchengemeindeordnung und weiterer Regelungen (Beilage 143)
- TOP 24 Schlussbericht des Rechtsausschusses
- TOP 25 Selbständige Anträge
- TOP 26 Förmliche Anfragen
- TOP 27 Schlussbericht des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung
- TOP 28 Schlussbericht des Theologischen Ausschusses
- TOP 29 Abschlussbericht des Projekts „Geistlich Leiten, vom Geist geleitet“
- TOP 30 Schlussbericht des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung
- TOP 31 „Raum geben“ - Zwischenbericht zu den Projekten „Aufbruch Quartier“ und „Aufbruch Wohnen“
- TOP 32 Abschlussbericht des Projekts „Zukunftsgutscheine”
- TOP 33 Zwischenbericht zum Fonds „#miteinander“
- TOP 34 Schlussbericht des Ausschusses für Diakonie
- TOP 35 Schlussbericht des Sonderausschusses für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte
- TOP 36 Abschluss der 16. Landessynode
- Gottesdienst mit Abendmahl in der Stiftskirche
Die Förmliche Anfrage Nr. 52/16 fragt nach:
- umfangreichen statistischen Auskünften zur Haushaltsaufstellung durch die Kirchengemeinden;
- den Gründen dafür, dass in manchen Gemeinden für 2025 kein Haushalt aufgestellt worden ist;
- den Folgen, die entstehen, wenn Kirchengemeinden keinen Haushalt aufstellen können.
Die detaillierten Antworten von Oberkirchenrat Dr. Christian Schuler finden Sie in seinem Bericht in den Dokumenten zu diesem Tagesordnungspunkt.
Die Dokumente zu TOP 26 finden Sie in der Klappbox oben: Dokumente zu Tagesordnungspunkt 26
TOP 27 Schlussbericht des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung
Alle Themen der Tagung
⬆️ Zum Seitenanfang
✳️Landessynode kompakt: Die wichtigsten Themen im Überblick
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente:
- Grußworte
- Verabschiedung der Unabhängigen Kommission zur Gewährung von Leistungen in Anerkennung des Leids Betroffener sexualisierter Gewalt und Verleihung der Silbernen Brenz-Medaille an den Vorsitzenden Wolfgang Vögele
- TOP 01 Strategische Planung
- TOP 02 Planüberschreitungen und Jahresabschluss der landeskirchlichen Rechnung 2024
TOP 03 1. Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 mit Kirchlichem Gesetz - TOP 04 Trauung gleichgeschlechtlich liebender Ehepaare
- TOP 05
- TOP 06 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung und des Gottesdienstes anlässlich der Eheschließung (Beilage 145)
- TOP 07 Kirchliches Gesetz zur Ablösung des Diakonen- und Diakoninnengesetzes und zur Änderung des Württ. Pfarrergesetzes (Beilage 141)
- TOP 08 Kirchliches Gesetz zur Änderung von Dienstverpflichtungen (Beilage 140)
- TOP 09 Gottesdienstbuch für die Ev. Landeskirche in Württemberg, Zweiter Teil, Teilband Einführungen und Verabschiedungen
- TOP 10 Bericht über die Situation der verfolgten Christen in der Welt sowie der Menschen, die aus religiösen, rassistischen, politischen, ethnischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gründen unter Verfolgung leiden – Schwerpunkt auf Syrien, Kolumbien, Nigeria und Pakistan
- TOP 11 Berichte des Beauftragten für die Entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs und des Islambeauftragten
- TOP 12 Aktuelle Stunde
- TOP 13 Schlussbericht des Ausschusses für Mission, Ökumene und Entwicklung
- TOP 14 Schlussbericht des Finanzausschusses
- TOP 15 Schlussbericht des Ausschusses für Bildung und Jugend
- TOP 16 Änderung des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes
- TOP 17 Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 18 Bericht der Projektstelle für die Themen Rassismus und Antisemitismus/Populismus und Extremismus
- Bildergalerie:Impressionen der Herbsttagung
- TOP 19 Abschaffung der Aktuellen Stunde
- TOP 20 OIKOS und die AKSB
- TOP 21 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (Beilage 142)
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (144)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Kirchengemeindeordnung und weiterer Regelungen (Beilage 143)
- TOP 24 Schlussbericht des Rechtsausschusses
- TOP 25 Selbständige Anträge
- TOP 26 Förmliche Anfragen
- TOP 27 Schlussbericht des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung
- TOP 28 Schlussbericht des Theologischen Ausschusses
- TOP 29 Abschlussbericht des Projekts „Geistlich Leiten, vom Geist geleitet“
- TOP 30 Schlussbericht des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung
- TOP 31 „Raum geben“ - Zwischenbericht zu den Projekten „Aufbruch Quartier“ und „Aufbruch Wohnen“
- TOP 32 Abschlussbericht des Projekts „Zukunftsgutscheine”
- TOP 33 Zwischenbericht zum Fonds „#miteinander“
- TOP 34 Schlussbericht des Ausschusses für Diakonie
- TOP 35 Schlussbericht des Sonderausschusses für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte
- TOP 36 Abschluss der 16. Landessynode
- Gottesdienst mit Abendmahl in der Stiftskirche
Dokumente zu Tagesordnungspunkt 27
Umfangreiche Agenda bearbeitet

Kai Münzing, Vorsitzender des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung, listete im Abschlussbericht eine Vielzahl von Themen auf, die der 2020 neu gegründete Ausschuss nach anfänglichen Diskussionen über seinen Zuschnitt und seine Aufgaben bearbeitet habe. Dies waren zum Beispiel die Verwaltungsstrukturreform, der PfarrPlan 2030, der DekanatsPlan und der Prälaturplan, Fusionsprozesse, Verbesserung der Kommunikationsstruktur und -kultur, Regio-Lokale Gemeindeentwicklung, Pfarrstellen für innovatives Handeln und Multiprofessionelle Teams, Innovationsfond und Innovationskongress, Quartiersentwicklung, Flex3, Ehrenamtskirche und vieles mehr. Die vollständige Liste finden Sie im schriftlichen Bericht in den Tagungsdokumenten. Zudem empfahl Münzing dem Folgeausschuss der 17. Landessynode einige Themen zur weiteren Bearbeitung. Auch diese finden Sie im schriftlichen Bericht.
Den vollständigen Bericht zu TOP 27 finden Sie in der Klappbox oben: Dokumente zu Tagesordnungspunkt 27
TOP 28 Schlussbericht des Theologischen Ausschusses
Alle Themen der Tagung
⬆️ Zum Seitenanfang
✳️Landessynode kompakt: Die wichtigsten Themen im Überblick
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente:
- Grußworte
- Verabschiedung der Unabhängigen Kommission zur Gewährung von Leistungen in Anerkennung des Leids Betroffener sexualisierter Gewalt und Verleihung der Silbernen Brenz-Medaille an den Vorsitzenden Wolfgang Vögele
- TOP 01 Strategische Planung
- TOP 02 Planüberschreitungen und Jahresabschluss der landeskirchlichen Rechnung 2024
TOP 03 1. Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 mit Kirchlichem Gesetz - TOP 04 Trauung gleichgeschlechtlich liebender Ehepaare
- TOP 05
- TOP 06 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung und des Gottesdienstes anlässlich der Eheschließung (Beilage 145)
- TOP 07 Kirchliches Gesetz zur Ablösung des Diakonen- und Diakoninnengesetzes und zur Änderung des Württ. Pfarrergesetzes (Beilage 141)
- TOP 08 Kirchliches Gesetz zur Änderung von Dienstverpflichtungen (Beilage 140)
- TOP 09 Gottesdienstbuch für die Ev. Landeskirche in Württemberg, Zweiter Teil, Teilband Einführungen und Verabschiedungen
- TOP 10 Bericht über die Situation der verfolgten Christen in der Welt sowie der Menschen, die aus religiösen, rassistischen, politischen, ethnischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gründen unter Verfolgung leiden – Schwerpunkt auf Syrien, Kolumbien, Nigeria und Pakistan
- TOP 11 Berichte des Beauftragten für die Entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs und des Islambeauftragten
- TOP 12 Aktuelle Stunde
- TOP 13 Schlussbericht des Ausschusses für Mission, Ökumene und Entwicklung
- TOP 14 Schlussbericht des Finanzausschusses
- TOP 15 Schlussbericht des Ausschusses für Bildung und Jugend
- TOP 16 Änderung des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes
- TOP 17 Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 18 Bericht der Projektstelle für die Themen Rassismus und Antisemitismus/Populismus und Extremismus
- Bildergalerie:Impressionen der Herbsttagung
- TOP 19 Abschaffung der Aktuellen Stunde
- TOP 20 OIKOS und die AKSB
- TOP 21 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (Beilage 142)
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (144)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Kirchengemeindeordnung und weiterer Regelungen (Beilage 143)
- TOP 24 Schlussbericht des Rechtsausschusses
- TOP 25 Selbständige Anträge
- TOP 26 Förmliche Anfragen
- TOP 27 Schlussbericht des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung
- TOP 28 Schlussbericht des Theologischen Ausschusses
- TOP 29 Abschlussbericht des Projekts „Geistlich Leiten, vom Geist geleitet“
- TOP 30 Schlussbericht des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung
- TOP 31 „Raum geben“ - Zwischenbericht zu den Projekten „Aufbruch Quartier“ und „Aufbruch Wohnen“
- TOP 32 Abschlussbericht des Projekts „Zukunftsgutscheine”
- TOP 33 Zwischenbericht zum Fonds „#miteinander“
- TOP 34 Schlussbericht des Ausschusses für Diakonie
- TOP 35 Schlussbericht des Sonderausschusses für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte
- TOP 36 Abschluss der 16. Landessynode
- Gottesdienst mit Abendmahl in der Stiftskirche
Dokumente zu Tagesordnungspunkt 28
Verabschiedung mit einem Blick nach vorne

Der Vorsitzende des Theologischen Ausschusses, Hellger Koepff, fasste im Schlussbericht die Themen der letzten fünf Jahre zusammen. Dabei legte er besonderen Wert auf jene, die nicht abgeschlossen wurden, wie theologische Fragestellungen im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt in der Kirche. Aber auch die Unterstützung der Kirchenmusik, Ausbildung und Amtsverständnis der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie die Verbesserung der seelsorgerlichen Kompetenz auf allen Ebenen seien weiterhin wichtige Themen. Er hoffe hier auf eine Fortführung durch die 17. Landessynode.
Den vollständigen Bericht zu TOP 28 finden Sie in der Klappbox oben: Dokumente zu Tagesordnungspunkt 28
TOP 29 Abschlussbericht des Projekts „Geistlich Leiten, vom Geist geleitet“
Alle Themen der Tagung
⬆️ Zum Seitenanfang
✳️Landessynode kompakt: Die wichtigsten Themen im Überblick
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente:
- Grußworte
- Verabschiedung der Unabhängigen Kommission zur Gewährung von Leistungen in Anerkennung des Leids Betroffener sexualisierter Gewalt und Verleihung der Silbernen Brenz-Medaille an den Vorsitzenden Wolfgang Vögele
- TOP 01 Strategische Planung
- TOP 02 Planüberschreitungen und Jahresabschluss der landeskirchlichen Rechnung 2024
TOP 03 1. Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 mit Kirchlichem Gesetz - TOP 04 Trauung gleichgeschlechtlich liebender Ehepaare
- TOP 05
- TOP 06 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung und des Gottesdienstes anlässlich der Eheschließung (Beilage 145)
- TOP 07 Kirchliches Gesetz zur Ablösung des Diakonen- und Diakoninnengesetzes und zur Änderung des Württ. Pfarrergesetzes (Beilage 141)
- TOP 08 Kirchliches Gesetz zur Änderung von Dienstverpflichtungen (Beilage 140)
- TOP 09 Gottesdienstbuch für die Ev. Landeskirche in Württemberg, Zweiter Teil, Teilband Einführungen und Verabschiedungen
- TOP 10 Bericht über die Situation der verfolgten Christen in der Welt sowie der Menschen, die aus religiösen, rassistischen, politischen, ethnischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gründen unter Verfolgung leiden – Schwerpunkt auf Syrien, Kolumbien, Nigeria und Pakistan
- TOP 11 Berichte des Beauftragten für die Entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs und des Islambeauftragten
- TOP 12 Aktuelle Stunde
- TOP 13 Schlussbericht des Ausschusses für Mission, Ökumene und Entwicklung
- TOP 14 Schlussbericht des Finanzausschusses
- TOP 15 Schlussbericht des Ausschusses für Bildung und Jugend
- TOP 16 Änderung des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes
- TOP 17 Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 18 Bericht der Projektstelle für die Themen Rassismus und Antisemitismus/Populismus und Extremismus
- Bildergalerie:Impressionen der Herbsttagung
- TOP 19 Abschaffung der Aktuellen Stunde
- TOP 20 OIKOS und die AKSB
- TOP 21 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (Beilage 142)
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (144)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Kirchengemeindeordnung und weiterer Regelungen (Beilage 143)
- TOP 24 Schlussbericht des Rechtsausschusses
- TOP 25 Selbständige Anträge
- TOP 26 Förmliche Anfragen
- TOP 27 Schlussbericht des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung
- TOP 28 Schlussbericht des Theologischen Ausschusses
- TOP 29 Abschlussbericht des Projekts „Geistlich Leiten, vom Geist geleitet“
- TOP 30 Schlussbericht des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung
- TOP 31 „Raum geben“ - Zwischenbericht zu den Projekten „Aufbruch Quartier“ und „Aufbruch Wohnen“
- TOP 32 Abschlussbericht des Projekts „Zukunftsgutscheine”
- TOP 33 Zwischenbericht zum Fonds „#miteinander“
- TOP 34 Schlussbericht des Ausschusses für Diakonie
- TOP 35 Schlussbericht des Sonderausschusses für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte
- TOP 36 Abschluss der 16. Landessynode
- Gottesdienst mit Abendmahl in der Stiftskirche
Dokumente zu Tagesordnungspunkt 29
Nachfrage nach Klausuren zur geistlichen Leitung war groß
Ausgehend von einem Schwerpunkttag der Sommersynode 2018 wurden, so Hellger Koepff, Vorsitzender des Theologischen Ausschusses, Gelder zur Förderung von Tagungen zum Thema „Geistlich Leiten“ für kirchenleitende Gremien bereitgestellt. Diese seien in mehr als 300 Anträgen abgerufen worden. Dies zeige, wie hoch der Bedarf sei. Oberkirchenrat Dr. Jörg Schneider ergänzte, dass dieses Thema daher nicht mit dem Projekt abgeschlossen wäre. Er verwies auf Zentren und Referate, die sich weiterhin mit geistlicher Leitung beschäftigen würden.
Den vollständigen Bericht zu TOP 29 finden Sie in der Klappbox oben: Dokumente zu Tagesordnungspunkt 29


TOP 30 Schlussbericht des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung
Alle Themen der Tagung
⬆️ Zum Seitenanfang
✳️Landessynode kompakt: Die wichtigsten Themen im Überblick
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente:
- Grußworte
- Verabschiedung der Unabhängigen Kommission zur Gewährung von Leistungen in Anerkennung des Leids Betroffener sexualisierter Gewalt und Verleihung der Silbernen Brenz-Medaille an den Vorsitzenden Wolfgang Vögele
- TOP 01 Strategische Planung
- TOP 02 Planüberschreitungen und Jahresabschluss der landeskirchlichen Rechnung 2024
TOP 03 1. Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 mit Kirchlichem Gesetz - TOP 04 Trauung gleichgeschlechtlich liebender Ehepaare
- TOP 05
- TOP 06 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung und des Gottesdienstes anlässlich der Eheschließung (Beilage 145)
- TOP 07 Kirchliches Gesetz zur Ablösung des Diakonen- und Diakoninnengesetzes und zur Änderung des Württ. Pfarrergesetzes (Beilage 141)
- TOP 08 Kirchliches Gesetz zur Änderung von Dienstverpflichtungen (Beilage 140)
- TOP 09 Gottesdienstbuch für die Ev. Landeskirche in Württemberg, Zweiter Teil, Teilband Einführungen und Verabschiedungen
- TOP 10 Bericht über die Situation der verfolgten Christen in der Welt sowie der Menschen, die aus religiösen, rassistischen, politischen, ethnischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gründen unter Verfolgung leiden – Schwerpunkt auf Syrien, Kolumbien, Nigeria und Pakistan
- TOP 11 Berichte des Beauftragten für die Entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs und des Islambeauftragten
- TOP 12 Aktuelle Stunde
- TOP 13 Schlussbericht des Ausschusses für Mission, Ökumene und Entwicklung
- TOP 14 Schlussbericht des Finanzausschusses
- TOP 15 Schlussbericht des Ausschusses für Bildung und Jugend
- TOP 16 Änderung des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes
- TOP 17 Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 18 Bericht der Projektstelle für die Themen Rassismus und Antisemitismus/Populismus und Extremismus
- Bildergalerie:Impressionen der Herbsttagung
- TOP 19 Abschaffung der Aktuellen Stunde
- TOP 20 OIKOS und die AKSB
- TOP 21 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (Beilage 142)
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (144)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Kirchengemeindeordnung und weiterer Regelungen (Beilage 143)
- TOP 24 Schlussbericht des Rechtsausschusses
- TOP 25 Selbständige Anträge
- TOP 26 Förmliche Anfragen
- TOP 27 Schlussbericht des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung
- TOP 28 Schlussbericht des Theologischen Ausschusses
- TOP 29 Abschlussbericht des Projekts „Geistlich Leiten, vom Geist geleitet“
- TOP 30 Schlussbericht des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung
- TOP 31 „Raum geben“ - Zwischenbericht zu den Projekten „Aufbruch Quartier“ und „Aufbruch Wohnen“
- TOP 32 Abschlussbericht des Projekts „Zukunftsgutscheine”
- TOP 33 Zwischenbericht zum Fonds „#miteinander“
- TOP 34 Schlussbericht des Ausschusses für Diakonie
- TOP 35 Schlussbericht des Sonderausschusses für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte
- TOP 36 Abschluss der 16. Landessynode
- Gottesdienst mit Abendmahl in der Stiftskirche
Dokumente zu Tagesordnungspunkt 30
Ausschuss übergibt Daueraufgaben an 17. Landessynode
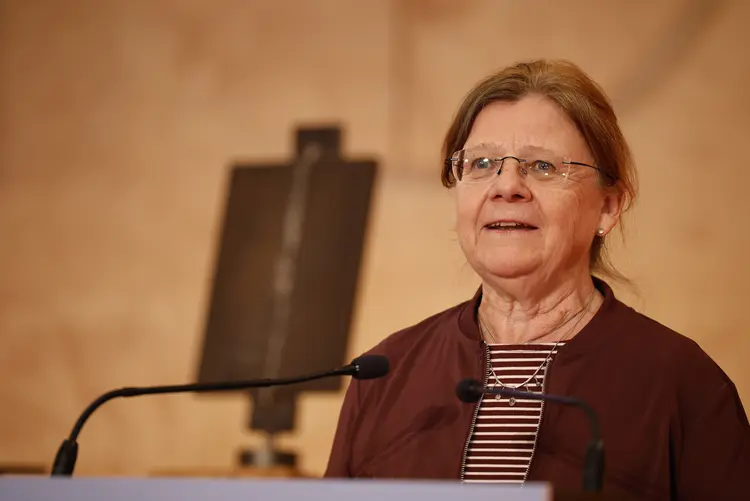
Annette Sawade, Vorsitzende des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung (KGS), zog im Abschlussbericht eine Bilanz der vergangenen sechs Jahre, in denen 41 Anträge in 34 Ausschusssitzungen bearbeitet wurden. Auf der Herbsttagung gab sie den Synodalen einen detaillierten Überblick, wie der Bearbeitungsstand bei den folgenden Themen ist:
- Antrag Nr. 08/25 „Aufarbeitung der Coronazeit und Förderung des Versöhnungsprozesses“
- Antrag Nr. 03/25 „Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt“
- Antrag Nr. 24/25 „OIKOS und die AKSB“
- Antrag Nr. 22/25 „Aufruf des unabhängigen Ökumenischen Friedenszentrums beim Kirchentag in Hannover“
Anschließend verwies Sawade auf eine Liste mit Daueraufgaben des KGS und appellierte an die kommende 17. Synode, diese nicht zu vergessen. Zum Schluss bedankte sie sich bei den Ausschussmitgliedern, der Geschäftsstelle der Landessynode und dem Oberkirchenrat für die Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren.
Aussprache
Der Erstunterzeichner des Antrags 08/25 „Aufarbeitung der Coronazeit und Förderung des Versöhnungsprozesses“ berichtete Dr. Markus Ehrmann (Rot am See), dass er immer wieder darauf angesprochen werde, wie die Coronazeit in der Landeskirche aufgearbeitet werden würde. Daher erwarte er weiterhin eine Erklärung des Oberkirchenrats und des Landesbischofs.
Der Erstunterzeichner des Antrags Nr. 22/25 „Aufruf des unabhängigen Ökumenischen Friedenszentrums beim Kirchentag in Hannover“ Prof. Dr. Martin Plümicke (Reutlingen) hoffe, dass es dennoch zu einem Fachtag kommen würde, da es die Aufgabe von Christinnen und Christen sei, einen Weg zwischen Schwarz und Weiß zu finden.
Den vollständigen Bericht zu TOP 30 finden Sie in der Klappbox oben: Dokumente zu Tagesordnungspunkt 30
TOP 31 „Raum geben“ - Zwischenbericht zu den Projekten „Aufbruch Quartier“ und „Aufbruch Wohnen“
Alle Themen der Tagung
⬆️ Zum Seitenanfang
✳️Landessynode kompakt: Die wichtigsten Themen im Überblick
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente:
- Grußworte
- Verabschiedung der Unabhängigen Kommission zur Gewährung von Leistungen in Anerkennung des Leids Betroffener sexualisierter Gewalt und Verleihung der Silbernen Brenz-Medaille an den Vorsitzenden Wolfgang Vögele
- TOP 01 Strategische Planung
- TOP 02 Planüberschreitungen und Jahresabschluss der landeskirchlichen Rechnung 2024
TOP 03 1. Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 mit Kirchlichem Gesetz - TOP 04 Trauung gleichgeschlechtlich liebender Ehepaare
- TOP 05
- TOP 06 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung und des Gottesdienstes anlässlich der Eheschließung (Beilage 145)
- TOP 07 Kirchliches Gesetz zur Ablösung des Diakonen- und Diakoninnengesetzes und zur Änderung des Württ. Pfarrergesetzes (Beilage 141)
- TOP 08 Kirchliches Gesetz zur Änderung von Dienstverpflichtungen (Beilage 140)
- TOP 09 Gottesdienstbuch für die Ev. Landeskirche in Württemberg, Zweiter Teil, Teilband Einführungen und Verabschiedungen
- TOP 10 Bericht über die Situation der verfolgten Christen in der Welt sowie der Menschen, die aus religiösen, rassistischen, politischen, ethnischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gründen unter Verfolgung leiden – Schwerpunkt auf Syrien, Kolumbien, Nigeria und Pakistan
- TOP 11 Berichte des Beauftragten für die Entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs und des Islambeauftragten
- TOP 12 Aktuelle Stunde
- TOP 13 Schlussbericht des Ausschusses für Mission, Ökumene und Entwicklung
- TOP 14 Schlussbericht des Finanzausschusses
- TOP 15 Schlussbericht des Ausschusses für Bildung und Jugend
- TOP 16 Änderung des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes
- TOP 17 Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 18 Bericht der Projektstelle für die Themen Rassismus und Antisemitismus/Populismus und Extremismus
- Bildergalerie:Impressionen der Herbsttagung
- TOP 19 Abschaffung der Aktuellen Stunde
- TOP 20 OIKOS und die AKSB
- TOP 21 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (Beilage 142)
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (144)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Kirchengemeindeordnung und weiterer Regelungen (Beilage 143)
- TOP 24 Schlussbericht des Rechtsausschusses
- TOP 25 Selbständige Anträge
- TOP 26 Förmliche Anfragen
- TOP 27 Schlussbericht des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung
- TOP 28 Schlussbericht des Theologischen Ausschusses
- TOP 29 Abschlussbericht des Projekts „Geistlich Leiten, vom Geist geleitet“
- TOP 30 Schlussbericht des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung
- TOP 31 „Raum geben“ - Zwischenbericht zu den Projekten „Aufbruch Quartier“ und „Aufbruch Wohnen“
- TOP 32 Abschlussbericht des Projekts „Zukunftsgutscheine”
- TOP 33 Zwischenbericht zum Fonds „#miteinander“
- TOP 34 Schlussbericht des Ausschusses für Diakonie
- TOP 35 Schlussbericht des Sonderausschusses für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte
- TOP 36 Abschluss der 16. Landessynode
- Gottesdienst mit Abendmahl in der Stiftskirche
Dokumente zu Tagesordnungspunkt 31
Zwei „richtungsweisende Projekte“
Prof. Dr. Annette Noller, Vorstandsvorsitzende des Diakonischen Werks Württemberg (DWW), stellte gemeinsam mit dem Fachreferent des DWW, Götz Kanzleiter, den aktuellen Stand der beiden Projekte Aufbruch Quartier und Aufbruch Wohnen vor.
Noller betonte, die Landeskirche habe damit „zwei richtungsweisende Projekte gestartet, die Antworten auf aktuelle gesellschaftliche Fragen geben und zeigen, wie Kirche und Gesellschaft zukunftsfähig und sozial gestaltet werden können.“ Aufbruch Wohnen eröffne neue Perspektiven auf die Nutzung unserer Immobilien, schaffe Zugänge zu Wohnraum und entwickle tragfähige Modelle für diakonisch-kirchliches Wohnen. Aufbruch Quartier ermögliche Vernetzung, entdecke Chancen im Sozialraum, aktiviere Menschen, stärke Nachbarschaften und eröffne neue Formen kirchlicher Präsenz.
Den vollständigen Bericht zu TOP 31 finden Sie in der Klappbox oben: Dokumente zu Tagesordnungspunkt 31


TOP 32 Abschlussbericht des Projekts „Zukunftsgutscheine”
Alle Themen der Tagung
⬆️ Zum Seitenanfang
✳️Landessynode kompakt: Die wichtigsten Themen im Überblick
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente:
- Grußworte
- Verabschiedung der Unabhängigen Kommission zur Gewährung von Leistungen in Anerkennung des Leids Betroffener sexualisierter Gewalt und Verleihung der Silbernen Brenz-Medaille an den Vorsitzenden Wolfgang Vögele
- TOP 01 Strategische Planung
- TOP 02 Planüberschreitungen und Jahresabschluss der landeskirchlichen Rechnung 2024
TOP 03 1. Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 mit Kirchlichem Gesetz - TOP 04 Trauung gleichgeschlechtlich liebender Ehepaare
- TOP 05
- TOP 06 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung und des Gottesdienstes anlässlich der Eheschließung (Beilage 145)
- TOP 07 Kirchliches Gesetz zur Ablösung des Diakonen- und Diakoninnengesetzes und zur Änderung des Württ. Pfarrergesetzes (Beilage 141)
- TOP 08 Kirchliches Gesetz zur Änderung von Dienstverpflichtungen (Beilage 140)
- TOP 09 Gottesdienstbuch für die Ev. Landeskirche in Württemberg, Zweiter Teil, Teilband Einführungen und Verabschiedungen
- TOP 10 Bericht über die Situation der verfolgten Christen in der Welt sowie der Menschen, die aus religiösen, rassistischen, politischen, ethnischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gründen unter Verfolgung leiden – Schwerpunkt auf Syrien, Kolumbien, Nigeria und Pakistan
- TOP 11 Berichte des Beauftragten für die Entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs und des Islambeauftragten
- TOP 12 Aktuelle Stunde
- TOP 13 Schlussbericht des Ausschusses für Mission, Ökumene und Entwicklung
- TOP 14 Schlussbericht des Finanzausschusses
- TOP 15 Schlussbericht des Ausschusses für Bildung und Jugend
- TOP 16 Änderung des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes
- TOP 17 Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 18 Bericht der Projektstelle für die Themen Rassismus und Antisemitismus/Populismus und Extremismus
- Bildergalerie:Impressionen der Herbsttagung
- TOP 19 Abschaffung der Aktuellen Stunde
- TOP 20 OIKOS und die AKSB
- TOP 21 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (Beilage 142)
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (144)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Kirchengemeindeordnung und weiterer Regelungen (Beilage 143)
- TOP 24 Schlussbericht des Rechtsausschusses
- TOP 25 Selbständige Anträge
- TOP 26 Förmliche Anfragen
- TOP 27 Schlussbericht des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung
- TOP 28 Schlussbericht des Theologischen Ausschusses
- TOP 29 Abschlussbericht des Projekts „Geistlich Leiten, vom Geist geleitet“
- TOP 30 Schlussbericht des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung
- TOP 31 „Raum geben“ - Zwischenbericht zu den Projekten „Aufbruch Quartier“ und „Aufbruch Wohnen“
- TOP 32 Abschlussbericht des Projekts „Zukunftsgutscheine”
- TOP 33 Zwischenbericht zum Fonds „#miteinander“
- TOP 34 Schlussbericht des Ausschusses für Diakonie
- TOP 35 Schlussbericht des Sonderausschusses für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte
- TOP 36 Abschluss der 16. Landessynode
- Gottesdienst mit Abendmahl in der Stiftskirche
Dokumente zu Tagesordnungspunkt 32
Konkrete Hilfe für Menschen am Rand unserer Gesellschaft
Oberkirchenrätin Prof. Dr. Annette Noller, Vorstandsvorsitzende des Diakonischen Werkes Württemberg (DWW) und Holger Fuhrmann, Referent Arbeitslosenhilfe im DWW, berichteten über das Projekt „Zukunftsgutscheine“, das langzeitarbeitslose Menschen mit ganzheitlichem Coaching und finanzieller Förderung unterstützt hatte, um ihnen einen beruflichen Neustart zu ermöglichen.
An acht Modellstandorten wurden 83 Teilnehmende individuell begleitet, wobei über 80 % spürbare Verbesserungen in Gesundheit, Alltag und sozialem Umfeld erfuhren und mehr als die Hälfte eine Arbeitsaufnahme oder Qualifizierung erreichten.
Noller resümierte, das Projekt stärke die Zusammenarbeit zwischen Kirche, Diakonie und freien Trägern und setze ein deutliches Zeichen kirchlicher Solidarität für Menschen in prekären Lebenslagen.
Den vollständigen Bericht zu TOP 32 finden Sie in der Klappbox oben: Dokumente zu Tagesordnungspunkt 32


TOP 33 Zwischenbericht des Zuwendungsfonds „#miteinander“
Alle Themen der Tagung
⬆️ Zum Seitenanfang
✳️Landessynode kompakt: Die wichtigsten Themen im Überblick
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente:
- Grußworte
- Verabschiedung der Unabhängigen Kommission zur Gewährung von Leistungen in Anerkennung des Leids Betroffener sexualisierter Gewalt und Verleihung der Silbernen Brenz-Medaille an den Vorsitzenden Wolfgang Vögele
- TOP 01 Strategische Planung
- TOP 02 Planüberschreitungen und Jahresabschluss der landeskirchlichen Rechnung 2024
TOP 03 1. Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 mit Kirchlichem Gesetz - TOP 04 Trauung gleichgeschlechtlich liebender Ehepaare
- TOP 05
- TOP 06 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung und des Gottesdienstes anlässlich der Eheschließung (Beilage 145)
- TOP 07 Kirchliches Gesetz zur Ablösung des Diakonen- und Diakoninnengesetzes und zur Änderung des Württ. Pfarrergesetzes (Beilage 141)
- TOP 08 Kirchliches Gesetz zur Änderung von Dienstverpflichtungen (Beilage 140)
- TOP 09 Gottesdienstbuch für die Ev. Landeskirche in Württemberg, Zweiter Teil, Teilband Einführungen und Verabschiedungen
- TOP 10 Bericht über die Situation der verfolgten Christen in der Welt sowie der Menschen, die aus religiösen, rassistischen, politischen, ethnischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gründen unter Verfolgung leiden – Schwerpunkt auf Syrien, Kolumbien, Nigeria und Pakistan
- TOP 11 Berichte des Beauftragten für die Entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs und des Islambeauftragten
- TOP 12 Aktuelle Stunde
- TOP 13 Schlussbericht des Ausschusses für Mission, Ökumene und Entwicklung
- TOP 14 Schlussbericht des Finanzausschusses
- TOP 15 Schlussbericht des Ausschusses für Bildung und Jugend
- TOP 16 Änderung des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes
- TOP 17 Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 18 Bericht der Projektstelle für die Themen Rassismus und Antisemitismus/Populismus und Extremismus
- Bildergalerie:Impressionen der Herbsttagung
- TOP 19 Abschaffung der Aktuellen Stunde
- TOP 20 OIKOS und die AKSB
- TOP 21 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (Beilage 142)
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (144)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Kirchengemeindeordnung und weiterer Regelungen (Beilage 143)
- TOP 24 Schlussbericht des Rechtsausschusses
- TOP 25 Selbständige Anträge
- TOP 26 Förmliche Anfragen
- TOP 27 Schlussbericht des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung
- TOP 28 Schlussbericht des Theologischen Ausschusses
- TOP 29 Abschlussbericht des Projekts „Geistlich Leiten, vom Geist geleitet“
- TOP 30 Schlussbericht des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung
- TOP 31 „Raum geben“ - Zwischenbericht zu den Projekten „Aufbruch Quartier“ und „Aufbruch Wohnen“
- TOP 32 Abschlussbericht des Projekts „Zukunftsgutscheine”
- TOP 33 Zwischenbericht zum Fonds „#miteinander“
- TOP 34 Schlussbericht des Ausschusses für Diakonie
- TOP 35 Schlussbericht des Sonderausschusses für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte
- TOP 36 Abschluss der 16. Landessynode
- Gottesdienst mit Abendmahl in der Stiftskirche
Dokumente zu Tagesordnungspunkt 33
Gelder des Fonds #miteinaner kommen bei Menschen in Not an
Oberkirchenrätin Prof. Dr. Annette Noller, Vorstandsvorsitzende DWW, und Nadine Bernecker, Referentin Bezirksdiakonie im Diakonischen Werk Württemberg (DWW), berichteten vom aktuellen Stand des Zuwendungsfonds „#miteinander“. Fast 3,8 Millionen Euro des Zuwendungsfonds wären bereits für Einzelfallhilfen und Konzeptförderungen abgerufen worden. Es sei gelungen, die Gelder schnell und effizient dorthin fließen zu lassen, wo sie benötigt werden. Noch bis Ende des Jahres 2025 können weitere Anträge gestellt werden.
Den vollständigen Bericht zu TOP 33 finden Sie in der Klappbox oben: Dokumente zu Tagesordnungspunkt 33


TOP 34 Schlussbericht des Ausschusses für Diakonie
Alle Themen der Tagung
⬆️ Zum Seitenanfang
✳️Landessynode kompakt: Die wichtigsten Themen im Überblick
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente:
- Grußworte
- Verabschiedung der Unabhängigen Kommission zur Gewährung von Leistungen in Anerkennung des Leids Betroffener sexualisierter Gewalt und Verleihung der Silbernen Brenz-Medaille an den Vorsitzenden Wolfgang Vögele
- TOP 01 Strategische Planung
- TOP 02 Planüberschreitungen und Jahresabschluss der landeskirchlichen Rechnung 2024
TOP 03 1. Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 mit Kirchlichem Gesetz - TOP 04 Trauung gleichgeschlechtlich liebender Ehepaare
- TOP 05
- TOP 06 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung und des Gottesdienstes anlässlich der Eheschließung (Beilage 145)
- TOP 07 Kirchliches Gesetz zur Ablösung des Diakonen- und Diakoninnengesetzes und zur Änderung des Württ. Pfarrergesetzes (Beilage 141)
- TOP 08 Kirchliches Gesetz zur Änderung von Dienstverpflichtungen (Beilage 140)
- TOP 09 Gottesdienstbuch für die Ev. Landeskirche in Württemberg, Zweiter Teil, Teilband Einführungen und Verabschiedungen
- TOP 10 Bericht über die Situation der verfolgten Christen in der Welt sowie der Menschen, die aus religiösen, rassistischen, politischen, ethnischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gründen unter Verfolgung leiden – Schwerpunkt auf Syrien, Kolumbien, Nigeria und Pakistan
- TOP 11 Berichte des Beauftragten für die Entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs und des Islambeauftragten
- TOP 12 Aktuelle Stunde
- TOP 13 Schlussbericht des Ausschusses für Mission, Ökumene und Entwicklung
- TOP 14 Schlussbericht des Finanzausschusses
- TOP 15 Schlussbericht des Ausschusses für Bildung und Jugend
- TOP 16 Änderung des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes
- TOP 17 Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 18 Bericht der Projektstelle für die Themen Rassismus und Antisemitismus/Populismus und Extremismus
- Bildergalerie:Impressionen der Herbsttagung
- TOP 19 Abschaffung der Aktuellen Stunde
- TOP 20 OIKOS und die AKSB
- TOP 21 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (Beilage 142)
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (144)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Kirchengemeindeordnung und weiterer Regelungen (Beilage 143)
- TOP 24 Schlussbericht des Rechtsausschusses
- TOP 25 Selbständige Anträge
- TOP 26 Förmliche Anfragen
- TOP 27 Schlussbericht des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung
- TOP 28 Schlussbericht des Theologischen Ausschusses
- TOP 29 Abschlussbericht des Projekts „Geistlich Leiten, vom Geist geleitet“
- TOP 30 Schlussbericht des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung
- TOP 31 „Raum geben“ - Zwischenbericht zu den Projekten „Aufbruch Quartier“ und „Aufbruch Wohnen“
- TOP 32 Abschlussbericht des Projekts „Zukunftsgutscheine”
- TOP 33 Zwischenbericht zum Fonds „#miteinander“
- TOP 34 Schlussbericht des Ausschusses für Diakonie
- TOP 35 Schlussbericht des Sonderausschusses für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte
- TOP 36 Abschluss der 16. Landessynode
- Gottesdienst mit Abendmahl in der Stiftskirche
Dokumente zu Tagesordnungspunkt 34
Diakonie-Ausschuss für Innen- und Außenwirkung wichtig

Jörg Beurer, Vorsitzender des Ausschusses für Diakonie, begann seinen Bericht mit einem Rückblick und rief in Erinnerung, welche Anträge vom Ausschuss in der vergangenen Legislaturperiode bearbeitet wurden. Anschließend zählte er auf, mit welchen Personen und Stellen gut zusammengearbeitet wurde, und bedankte sich dafür. Beurer gab der kommenden Landessynode fünf Themen mit auf den Weg, an denen weiterzuarbeiten, sich lohne. Abschließend empfahl er, an einem eigenständigen Ausschuss für Diakonie festzuhalten – „für Diakonie und Diakonat, für die Wirkung innerhalb und außerhalb der Kirche“. Das Selbstverständnis des Ausschusses brachte Beurer zum Ende seiner Rede mit der Formel „Die Kirche ist nur eine christliche Kirche, wenn sie auch Diakonie ist“ zum Ausdruck.
Den vollständigen Bericht zu TOP 34 finden Sie in der Klappbox oben: Dokumente zu Tagesordnungspunkt 34
TOP 35 Schlussbericht des Sonderausschusses für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte
Alle Themen der Tagung
⬆️ Zum Seitenanfang
✳️Landessynode kompakt: Die wichtigsten Themen im Überblick
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente:
- Grußworte
- Verabschiedung der Unabhängigen Kommission zur Gewährung von Leistungen in Anerkennung des Leids Betroffener sexualisierter Gewalt und Verleihung der Silbernen Brenz-Medaille an den Vorsitzenden Wolfgang Vögele
- TOP 01 Strategische Planung
- TOP 02 Planüberschreitungen und Jahresabschluss der landeskirchlichen Rechnung 2024
TOP 03 1. Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 mit Kirchlichem Gesetz - TOP 04 Trauung gleichgeschlechtlich liebender Ehepaare
- TOP 05
- TOP 06 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung und des Gottesdienstes anlässlich der Eheschließung (Beilage 145)
- TOP 07 Kirchliches Gesetz zur Ablösung des Diakonen- und Diakoninnengesetzes und zur Änderung des Württ. Pfarrergesetzes (Beilage 141)
- TOP 08 Kirchliches Gesetz zur Änderung von Dienstverpflichtungen (Beilage 140)
- TOP 09 Gottesdienstbuch für die Ev. Landeskirche in Württemberg, Zweiter Teil, Teilband Einführungen und Verabschiedungen
- TOP 10 Bericht über die Situation der verfolgten Christen in der Welt sowie der Menschen, die aus religiösen, rassistischen, politischen, ethnischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gründen unter Verfolgung leiden – Schwerpunkt auf Syrien, Kolumbien, Nigeria und Pakistan
- TOP 11 Berichte des Beauftragten für die Entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs und des Islambeauftragten
- TOP 12 Aktuelle Stunde
- TOP 13 Schlussbericht des Ausschusses für Mission, Ökumene und Entwicklung
- TOP 14 Schlussbericht des Finanzausschusses
- TOP 15 Schlussbericht des Ausschusses für Bildung und Jugend
- TOP 16 Änderung des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes
- TOP 17 Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 18 Bericht der Projektstelle für die Themen Rassismus und Antisemitismus/Populismus und Extremismus
- Bildergalerie:Impressionen der Herbsttagung
- TOP 19 Abschaffung der Aktuellen Stunde
- TOP 20 OIKOS und die AKSB
- TOP 21 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (Beilage 142)
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (144)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Kirchengemeindeordnung und weiterer Regelungen (Beilage 143)
- TOP 24 Schlussbericht des Rechtsausschusses
- TOP 25 Selbständige Anträge
- TOP 26 Förmliche Anfragen
- TOP 27 Schlussbericht des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung
- TOP 28 Schlussbericht des Theologischen Ausschusses
- TOP 29 Abschlussbericht des Projekts „Geistlich Leiten, vom Geist geleitet“
- TOP 30 Schlussbericht des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung
- TOP 31 „Raum geben“ - Zwischenbericht zu den Projekten „Aufbruch Quartier“ und „Aufbruch Wohnen“
- TOP 32 Abschlussbericht des Projekts „Zukunftsgutscheine”
- TOP 33 Zwischenbericht zum Fonds „#miteinander“
- TOP 34 Schlussbericht des Ausschusses für Diakonie
- TOP 35 Schlussbericht des Sonderausschusses für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte
- TOP 36 Abschluss der 16. Landessynode
- Gottesdienst mit Abendmahl in der Stiftskirche
Dokumente zu Tagesordnungspunkt 35
Fünf Jahre Arbeit an der Zukunftssicherheit der Landeskirche

Maike Sachs, Vorsitzende des Sonderausschusses für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte, blickte im Abschlussbericht des Ausschusses auf dessen Arbeit in den vergangenen fünf Jahren zurück, an deren Anfang man noch davon ausgegangen war, der landeskirchliche Haushalt müsse um zehn Prozent reduziert werden. Seit 2024 sei aber klar gewesen, dass das Einsparvolumen bei rund 30 Prozent liegen müsse. Sachs dankte allen Beteiligten für das „gemeinsame Ringen um tragbare, wenn auch immer wieder schmerzhafte Entscheidungen“. Zum Abschluss erklärte sie, dass zwei noch offene Anträge nach Empfehlung des Sonderausschusses und der jeweiligen Fachausschüsse nicht weiterverfolgt werden sollen:
- Antrag Nr. 37/23 über die Gründung eines Verbands der württembergischen und der badischen Landeskirche.
- Antrag Nr. 30/24 über die Bezuschussung des Evangelischen Blinden- und Sehbehindertendienstes Württemberg
Den vollständigen Bericht zu TOP 35 finden Sie in der Klappbox oben: Dokumente zu Tagesordnungspunkt 35
TOP 36 Abschluss der 16. Landessynode
Alle Themen der Tagung
⬆️ Zum Seitenanfang
✳️Landessynode kompakt: Die wichtigsten Themen im Überblick
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente:
- Grußworte
- Verabschiedung der Unabhängigen Kommission zur Gewährung von Leistungen in Anerkennung des Leids Betroffener sexualisierter Gewalt und Verleihung der Silbernen Brenz-Medaille an den Vorsitzenden Wolfgang Vögele
- TOP 01 Strategische Planung
- TOP 02 Planüberschreitungen und Jahresabschluss der landeskirchlichen Rechnung 2024
TOP 03 1. Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 mit Kirchlichem Gesetz - TOP 04 Trauung gleichgeschlechtlich liebender Ehepaare
- TOP 05
- TOP 06 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung und des Gottesdienstes anlässlich der Eheschließung (Beilage 145)
- TOP 07 Kirchliches Gesetz zur Ablösung des Diakonen- und Diakoninnengesetzes und zur Änderung des Württ. Pfarrergesetzes (Beilage 141)
- TOP 08 Kirchliches Gesetz zur Änderung von Dienstverpflichtungen (Beilage 140)
- TOP 09 Gottesdienstbuch für die Ev. Landeskirche in Württemberg, Zweiter Teil, Teilband Einführungen und Verabschiedungen
- TOP 10 Bericht über die Situation der verfolgten Christen in der Welt sowie der Menschen, die aus religiösen, rassistischen, politischen, ethnischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gründen unter Verfolgung leiden – Schwerpunkt auf Syrien, Kolumbien, Nigeria und Pakistan
- TOP 11 Berichte des Beauftragten für die Entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs und des Islambeauftragten
- TOP 12 Aktuelle Stunde
- TOP 13 Schlussbericht des Ausschusses für Mission, Ökumene und Entwicklung
- TOP 14 Schlussbericht des Finanzausschusses
- TOP 15 Schlussbericht des Ausschusses für Bildung und Jugend
- TOP 16 Änderung des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes
- TOP 17 Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 18 Bericht der Projektstelle für die Themen Rassismus und Antisemitismus/Populismus und Extremismus
- Bildergalerie:Impressionen der Herbsttagung
- TOP 19 Abschaffung der Aktuellen Stunde
- TOP 20 OIKOS und die AKSB
- TOP 21 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (Beilage 142)
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (144)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Kirchengemeindeordnung und weiterer Regelungen (Beilage 143)
- TOP 24 Schlussbericht des Rechtsausschusses
- TOP 25 Selbständige Anträge
- TOP 26 Förmliche Anfragen
- TOP 27 Schlussbericht des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung
- TOP 28 Schlussbericht des Theologischen Ausschusses
- TOP 29 Abschlussbericht des Projekts „Geistlich Leiten, vom Geist geleitet“
- TOP 30 Schlussbericht des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung
- TOP 31 „Raum geben“ - Zwischenbericht zu den Projekten „Aufbruch Quartier“ und „Aufbruch Wohnen“
- TOP 32 Abschlussbericht des Projekts „Zukunftsgutscheine”
- TOP 33 Zwischenbericht zum Fonds „#miteinander“
- TOP 34 Schlussbericht des Ausschusses für Diakonie
- TOP 35 Schlussbericht des Sonderausschusses für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte
- TOP 36 Abschluss der 16. Landessynode
- Gottesdienst mit Abendmahl in der Stiftskirche
Dokumente zu Tagesordnungspunkt 36
Ansprachen der Synodalpräsidentin, des ältesten Mitglieds der Synode, der Gesprächskreisleitungen und des Landesbischofs läuteten das Ende der 16. Landessynode ein. Hier finden Sie die Reden im Volltext, soweit die Manuskripte der Redaktion vorlagen.
Ansprache des ältesten Mitglieds der Landessynode
Volltext der Ansprache von Hannelore Jessen
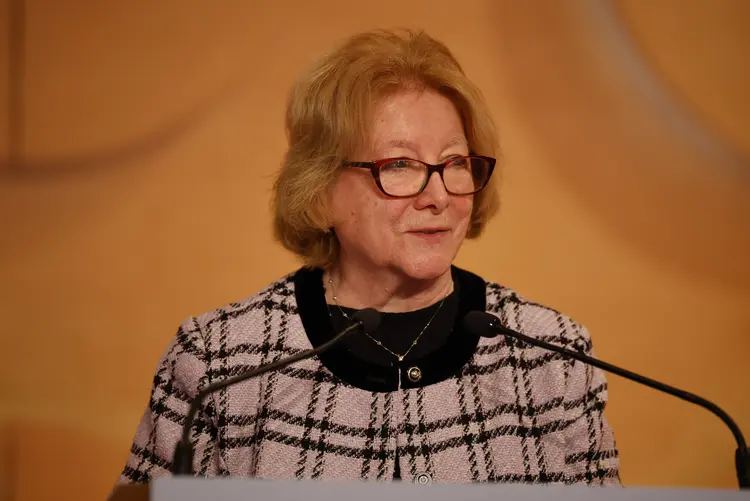
Sehr geehrte Frau Präsidentin,
Werte Synode,
liebe Geschwister,
„wir sind heute hier versammelt, um gemeinsam zurückzublicken – und zugleich nach vorn zu schauen. Inmitten all dessen, was uns im vergangenen Jahr oder in dieser gemeinsamen Zeit bewegt hat, stehen drei ewige Begleiter unseres Glaubens: Glaube, Liebe und Hoffnung.
Der Glaube – er trägt uns durch schwere Zeiten, er schenkt uns Halt, wenn die Welt um uns ins Wanken gerät. Der Glaube verbindet uns mit Gott – und miteinander. Die Liebe – sie ist das größte Gebot. Sie macht unsere Gemeinschaft menschlich. Ohne Liebe bleiben unsere Worte leer und unsere Taten bedeutungslos. Und die Hoffnung – sie schaut nach vorn. Hoffnung ist das Licht, das uns durch den Wandel führt.
Wandel – ja, Wandel ist ein Wort, das viele von uns vielleicht mit Unsicherheit verbinden. Doch als Christinnen und Christen wissen wir: Wandel ist Teil des göttlichen Plans. In der Bibel lesen wir immer wieder von Veränderung, von Aufbruch, von Neuanfang. Abraham verließ seine Heimat, Mose führte sein Volk durch die Wüste, Jesus selbst ging neue Wege – oft gegen den Strom.
Auch wir stehen immer wieder an Schwellen. Wir erleben Wandel in der Kirche, in unserer Gesellschaft, in unserem persönlichen Leben. Alte Strukturen weichen neuen Gedanken – und das ist gut so.
Denn Wandel bringt Zukunft – und Zukunft braucht Mut. Aber sie braucht auch Gemeinschaft. Nur gemeinsam – als Frauen und Männer, als Kinder, Jugendliche und Erwachsene – können wir Brücken bauen zwischen Alt und Neu, zwischen Tradition und Aufbruch.“
Soweit die KI – vielleicht kommt Ihnen der Schreibstil bekannt vor, ich weiß nicht, wer hier im Raum seine Predigten mit Hilfe der KI schreibt. Und voraussagen mag ich auch nicht, wohin uns diese neue Errungenschaft führt: Vielleicht wird der Literatur-Nobel-Preis zum Beispiel nicht mehr an eine Person, sondern an Chatbot 67923 verliehen. Sie dürfen sich noch selbst Gedanken dazu machen.
Aber für den Wandel sollten wir auch Vernunft einsetzen, die Menschheit muss ständig mit Veränderungen umgehen, unsere Gemeinden kämpfen mit den neuen Verordnungen und Anweisungen und sind enttäuscht über den Verlust von Traditionen - nicht alles ist aus der Vernunft geboren.
Wir haben uns mit vielem auseinandergesetzt, aber zuerst mal wurden wir kurz nach dem hoffnungsvollen Start „auseinander“ gesetzt oder auf den Bildschirm verbannt. Da gab es wenig Möglichkeiten, Mitsynodale zu verstehen oder einander anzunehmen, außer denen, die schon in der 15. Landesynode dabei waren. Argumente und Standpunkte wurden derer viele inzwischen ausgetauscht. Und auch der 17. Synode umfangreiche Empfehlungen gegeben.
Zumindest sind wir schnell in die Welt der Medien eingetaucht und so sind wir „zukunftsfähig“ gemacht worden.
Aber wir sollten nicht verkennen, Fortschritt ist nicht unbedingt eine Erleichterung, wie in allen Gebieten nutzen unsere Unwissenheit oder unsere Unbekümmertheit unlautere oder geschäftstüchtige Mitmenschen aus. Besonders bedroht sind in unserer Gesellschaft durch perfide Machenschaften Kinder und Ältere. Ganz abgesehen von der umfangreichen Speicherung unserer persönlichen Daten, wo wir bisher nicht wissen, wozu sie genutzt oder missbraucht werden.
Die KI hält für uns Kluges bereit, ich zitiere:
„In dieser Gemeinschaft achten wir einander. Respekt und Achtung sollen unser Miteinander prägen – über alle Unterschiede hinweg. Jeder Mensch, ob jung oder alt, ob laut oder leise, bringt Gaben mit, die von Gott geschenkt sind. Die Jugend bringt frischen Wind, neue Ideen, Fragen, die uns herausfordern. Die Älteren bringen Erfahrung, Weisheit, Stabilität. Menschen – mit unterschiedlichen Lebenswegen, aber gleicher Würde vor Gott – wirken gemeinsam am Bau seiner Kirche.“ Zitatende.
Es ist wohl mehr ein Umbau – aber wir werden auf Gott vertrauen und an einer besseren und gerechteren Welt bauen. Und haben Sie Mut, vor Ort in ihren Gemeinden kirchliches Leben zu gestalten und an der Ortsgemeinschaft mitzuwirken und haben Sie auch Mut für neue Projekte. Und wenn Sie keine offenen Ohren und Herzen finden, vielleicht funktionierts in der Nachbarschaft. Die Landeskirche ist nichts ohne aktive Gemeinden und Menschen.
Es hört sich so an, wenn wir die die letzten Jahreslosungen hintereinander sehen, 24 Alles was ihr tut, geschehe in Liebe, 25: Prüft alles und behaltet das Gute – haben wir wohl alles nicht so richtig hinbekommen, jetzt bekommen wir die Quittung: 26: Gott spricht, Siehe ich mache alles neu.
Aber 28 heißt es wieder: Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen.
Und hoffentlich gibt es für diese Welt bis dahin mehr Umweltbewusstsein, Menschenrechte und vor allen Dingen Frieden.
In diesem Sinne bleiben Sie behütet
(Hannelore Jessen, Ältestes Mitglied der 16. Landessynode)
Die vollständige Ansprache zum Downloaden finden Sie in der Klappbox oben: Dokumente zu Tagesordnungspunkt 36
Ansprache der Synodalpräsidentin der 16. Landessynode
Volltext der Ansprache der Synodalpräsidentin Sabine Foth

Liebe Synodale,
liebe Mitglieder des Kollegiums,
nun ist es so weit: Das Resümee als Präsidentin der 16. Landessynode. Alle, die mich kennen, wissen, dass ich lieber kurze Reden halte. Daher, keine Sorge, wir werden alle pünktlich zum Gottesdienst kommen.
In den vergangenen Monaten habe ich mich immer wieder gefragt, wie es sein kann, dass schon fast 6 Jahre vergangen sind. Kurz vor der Pandemie konnten wir unsere Konstituierende Sitzung abhalten, das Präsidium wie auch der Finanzausschuss konnten einmal präsentisch tagen und dann – einen Monat nach der Konstituierung, am 17. März 2020, hat der Geschäftsführende Ausschuss im Brenzsaal des damaligen OKR-Gebäudes getagt. Zwei Stunden, mit großem Abstand, in denen wir Kirchliche Anordnungen beschlossen und auf die staatlichen Maßnahmen reagiert haben. Wir waren unsicher, besorgt und haben aber nach bestem Wissen gehandelt. Im Rückblick kommen viele Frage auf, für die Zukunft bleibt noch die Aufgabe: Wie agieren, reagieren wir im Fall einer weiteren Pandemie oder ähnlichem?
Es folgten viele weitere digitale Sitzungen. Zum Glück hat bereits die 15. Landessynode - und hier möchte ich besonders Dir, liebe Inge als Präsidentin der 15. Landessynode und Motor des papierlosen Arbeitens danken - alle Voraussetzungen für digitales Arbeiten geschaffen. Synodengeräte waren schon vor der Konstituierung ausgehändigt, Teams auf jedem Rechner aufgespielt. So war der Schritt, die rechtliche Regelung, dass Ausschüsse, Synode wie auch die Kirchengemeinden audiovisuelle Sitzungen abhalten konnten klein. Ein kleiner Schritt für die Synode, aber ein großer im Allgemeinen. Denn – bis heute besteht die Möglichkeit der rein audiovisuellen, der hybriden Sitzungen, wie auch in besonderen Fällen der digitalen Teilnahme an den Synodaltagungen. Die Sorge, in Zukunft vor leeren oder zumindest fast leeren Stühlen zu tagen, hat sich zum Glück nicht bewahrheitet.
Nach der Pandemie kam die nächste Herausforderung für diese Landessynode: Die Kirchensteuer-einnahmen sanken. Dieses Mal nicht, wie in der Vergangenheit, als Ankündigung seitens des Finanzdezernates, sondern real. Wir hatten uns der harten Realität zu stellen: In vielen Sitzungen in den verschiedenen Geschäftsausschüssen und dem Sonderausschuss haben wir uns mit den Einsparvorschlägen des Oberkirchenrats beschäftigt. Auch gemeinsam mit dem Kollegium des Oberkirchenrats gab es eine Art Workshop. Eine Neuerung, die wir als Synode sehr begrüßt haben. Im gegenseitigen Vertrauen und im gemeinsamen Austausch, im Brainstorming und ohne fertige Vorlagen können schwierige Entscheidungen besser vorbereitet werden.
Hier danke ich ausdrücklich Herrn Direktor Werner. Lieber Stefan, Du hast immer wieder in den Ausschüssen auch auf den Werkstattcharakter gemeinsamen Nachdenkens hingewiesen. Ich würde mir wünschen, dass diese Art der vertrauensvollen Zusammenarbeit noch stärker ausgeweitet wird.
Wir haben in der Sommersynode 2020 den Sonderausschuss eingesetzt für Priorisierungen und Schwerpunktsetzungen. Besetzt war der Ausschuss mit Vertreter*innen der Gesprächskreisleitungen wie auch den Vorsitzenden der Geschäftsausschüsse. Mir ist bewusst, dass der Ausschuss schon für eine recht lange Zeit eingesetzt war, auch, dass insbesondere die Mitglieder des Finanzausschusses, lassen sie es mich so ausdrücke – dies als Einschränkung ihrer Kompetenz empfunden haben.
Die Intention des Sonderausschusses, die sich in der Zusammensetzung widerspiegelt, war die Bündelung der Kompetenzen der Geschäftsausschüsse, der Gesprächskreise, ein stetiger intensiver Austausch mit Synode und Oberkirchenrat. Der Ausschuss hat, wie im Übrigen alle unsere Geschäftsausschüsse hinter verschlossenen Türen getagt, natürlich, denn unsere Ausschüsse tagen nicht öffentlich. Aber jede und jeder Synodale hatte die Möglichkeit nach §28 Abs. 3 der Geschäftsordnung, dem Ausschuss beizuwohnen. Die sehr schnell fertig und eingestellten Protokolle waren allen Synodalen zugänglich, sodass die Transparenz der Beratung, abgesehen von den Rückkopplungen mit den Gesprächskreisen und Geschäftsausschüssen, gegeben war. Gerade die Besetzung dieses Sonderausschusses halte ich auch für mögliche inhaltlich übergreifende Fragestellungen in der Zukunft für wertvoll.
Der Geschäftsführende Ausschuss hat der 17. Landessynode die Empfehlung gegeben, mit der Badischen Landessynode gemeinsame Tagungen der Ausschüsse und ggf. der Landessynoden zu terminieren, das Präsidium der 17. Landessynode wird in dem Beschluss gebeten, das Fernziel einer Fusion beider Landeskirchen achtsam in Gesprächen mit dem badischen Präsidium auszuloten und anzubahnen und dabei auch die Erfahrungen anderen Landeskirchen diesbezüglich in den Blick zu nehmen. Es ist gut, dass wir uns mit Kooperationen auf den Weg gemacht haben. Es waren bislang kleine Schritte, abgesehen von der gelungenen Fusion der Archive und Bibliotheken. Hier müssen wir weiterkommen und auch zwischen den Synoden Themen gemeinsam bearbeiten, beispielsweise, wie bereits begonnen, auf Ebene der Geschäftsausschüsse. Die gemeinsamen Sitzungen der Präsidien und Ältestenräte waren immer vertrauensvoll und fruchtbar.
Auch der Ältestenrat hat einige Empfehlungen erarbeitet, die an die 17. Landessynode übergeben werden. Entscheiden wird hierüber die 17. Landessynode.
Mein persönlicher Wunsch, außer einer vertrauensvollen und offenen Zusammenarbeit zwischen Oberkirchenrat und Synode, ist, dass wir über den württembergischen Tellerrand hinausblicken. Württemberg ist schön, hat guten Wein, nette Menschen und übrigens auch bessere Brezeln als der Norden, aber - der Austausch mit anderen Landeskirchen, der weltweiten Kirche tut uns gut. Wir können voneinander und miteinander lernen. Von unseren Gemeinden fordern wir umdenken, Neues auszuprobieren, Flexibilität und Offenheit. In der 16. Landessynode habe ich dies an vielen Stellen gespürt und ich hoffe, dass diese Haltung weiterwächst.
Liebe Synodale,
ich danke Euch/danke Ihnen ganz herzlich für das große Vertrauen, dass Sie mir in den vergangenen 6 Jahren entgegengebracht haben. Ich nehme aus der Arbeit der 16. Landessynode mit, dass wir gemeinsam unterwegs waren, miteinander gerungen, gesprächskreisübergreifend Lösungen gesucht und in der überwiegenden Zahl gefunden haben. Beim engagierten Vertreten der eigenen Perspektive gerieten die Belange der gesamten Landeskirche nicht aus dem Blick.
Danke auch Dir, Ernst-Wilhelm, und Dir, Stefan. Wir haben einige Umbrüche gemeistert. Die Wege im Interim und im neuen Dienstgebäude waren kurz, aber auch ein schneller telefonischer Austausch war immer möglich. Das ist nicht selbstverständlich und dafür danke ich ausdrücklich.
Vergessen möchte ich auch nicht den Dank an Sie, lieber Herr Altbischof July. Während der Coronazeit haben Sie mich immer wieder in die Kollegialsitzungen eingeladen. Sie haben mich eingebunden, sodass die schwierigen Entscheidungen in der Coronazeit auf tragfähigen gemeinsamen Grund gestellt werden konnten.
Ich möchte mich bei allen Gesprächskreisleitenden bedanken. Der manchmal auch schnelle und spontane Austausch war mir sehr wichtig. Ihr habt euch auch untereinander ausgetauscht, habt miteinander gerungen und Lösungen gesucht. Habt über Gesprächskreisgrenzen hinweg nachgedacht. Das tut der Synode und der Landeskirche insgesamt gut.
Danke an den Oberkirchenrat für das Miteinander in guten wie in schlechten Zeiten. Wir sind zwei verschiedene Verfassungsorgane, die aus ihrem jeweils eigenen Blickwinkel argumentieren und entscheiden. Den Blickwinkel des jeweils anderen Gesprächspartners zu beachten, ist uns doch, mit wenigen Ausnahmen, gelungen. Kirche, auch ihre Verfassungsorgane, dürfen streiten, solange dies im Miteinander und wertschätzend geschieht. Dass in den neuen Räumen des Oberkirchenrats auch in den Sitzungsräumen Kaffee getrunken werden darf, erleichtert den Austausch sicherlich.
Ich danke Dir, liebe Andrea, lieber Johannes, für alle Geduld, alle Offenheit und unser immer besseres Zusammenwachsen. Schade, dass die Zeit nun schon vorbei ist! Wir waren nicht immer einer Meinung, aber doch meist. Wir konnten auch Meinungen stehen lassen. Unser persönlicher Austausch, unsere schnelle Kommunikationsstruktur und auch unsere Klausur am Anfang der Legislaturperiode habe ich als sehr wertvoll empfunden und ist auch eine Anregung für das neue Präsidium.
Danken möchte ich auch der Pressestelle. Lieber Dan, liebe Nadja, Ihr seid immer zur Stelle gewesen, wenn wir euch brauchten. Habt versucht, die Synode stärker als früher in den medialen Focus zu rücken. Danke!!
Danke hier auch an das Medienhaus, an Tobias Glawion, Frank Zeithammer und das super Team, denn auch ihr steht an der Seite der Synode bei den Aufzeichnungen.
Ich danke auch ganz herzlich dem Bischofsbüro für alle Unterstützung, insbesondere Mathilde Schneider und Claudia Herrschlein. Ich habe das Miteinander, den Austausch, auch privater Natur, sehr genossen. Wir haben gemeinsam gelacht und uns unterstützt. Gerade auch während der Unterbesetzung der Geschäftsstelle, warst Du, Claudia ja eigentlich ein Teil unserer Geschäftsstelle. Danke auch an Sie Herr Dr. Grevel, dass das so unkompliziert möglich war.
Last but noch Least: Liebe Geschäftsstelle, lieber Alex und Elmar, liebe Nathalie und Mareike. Euch ein ganz großes Dankeschön. Ihr wart immer für uns als Synode, für mich da (nicht nur mit Gummibärchen in stressigen Situationen) da. Ohne eine funktionierende Geschäftsstelle können Ehrenamtliche das synodale Amt nicht ausüben. Auf Euch ist Verlass!! Ihr habt schon seit Monaten den Übergang, den Neuanfang im Blick. Viel Kraft und Segen Euch. Ich bin aber froh, dass wir uns noch einige Male im Dienstgebäude sehen werden. Im Gegensatz zu manchen Anderen, sollt Ihr schon hier und jetzt eine kleine Anerkennung von uns allen Synodalen bekommen. Nutzbar ist sie gemeinsam oder allein oder mit Partner*innen, Freunden.
(Sabine Foth, Präsidentin der 16. Landessynode)
Die vollständige Ansprache zum Downloaden finden Sie in der Klappbox oben: Dokumente zu Tagesordnungspunkt 36
Ansprache des Landesbischofs
Volltext der Ansprache von Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl

Frau Präsidentin, hohe Synode!
Der Tag heute ist Anlass für große Dankbarkeit – sechs Jahre Synodalarbeit liegen hinter uns. Die 16. Landessynode ist nun bald Geschichte. Dankbar blicken wir auf das Erreichte zurück und wie bei jedem Rückblick mischt sich auch etwas Wehmut drunter.
In Zeiten, in denen die Verbundenheit vieler Menschen zur Kirche nachlässt, seid Ihr, liebe Synodale, die vielzitierten Hochverbundenen. Ihr seid in Euren Kirchengemeinden aktiv, im Kirchenbezirk, in zahlreichen Gremien der Landeskirchen und Ihr schultert die Synodalarbeit. Die Sitzungen der einzelnen Ausschüsse befassen sich mit komplexen Sachverhalten, die immer eine gründliche Einarbeitung und Vorbereitung erfordern. Für all die Mühe, Zeit und Kraft, die Ihr in diese Arbeit einbringt, danke ich Euch von Herzen!
Das Ende der Amtszeit ist eine Zäsur auch mit der Überlegung: Kandidiere ich nochmals oder ist jetzt für mich der Zeitpunkt gekommen, aufzuhören? Keine leichte Entscheidung. Ich hoffe, dass bei denen die, die nicht mehr kandidieren, positiven Erfahrungen mit dem bisweilen auch mühsamen „Synodalgeschäft“ überwiegen und sie sich weiter in unsere Kirche einbringen.
Dankbar sind wir. Daneben schwingt auch etwas Wehmut mit. Ich erinnere mich noch gut daran, wie es vor sechs Jahren war, als sich die neugewählte Landessynode konstituierte. Ich war einer von Euch. Da war der Rückenwind als gewählter Synodaler. Es gab viele Projekte und Ideen für eine Kirche im Umbruch. Drei Jahre später wurde ich dann von dieser Synode zum Landesbischof gewählt – ein Rollenwechsel mit neuen Aufgaben.
Danke für das Vertrauen, das Ihr mir entgegengebracht habt – auch nach der Wahl. Danke auch für alle konstruktive Kritik, wenn ich mal nicht rollenklar war oder Euch zu wenig zugehört habe.
Alles in allem habe ich Zusammenarbeit als sehr konstruktiv und offen erlebt. Wenn es irgendwo klemmte – was ja bisweilen vorkommen soll – habt Ihr mit eurer Kritik nicht hinter dem Berg gehalten. Und das ist wichtig. Denn nur, wenn die Irritation auch benannt wird, kann man sich dazu verhalten und nach Lösungen suchen.
Deshalb bedauere ich sehr, dass wir bei der Frage der Trauung gleichgeschlechtlicher Ehepaare in dieser Legislatur keine Lösung gefunden haben. Ich bedauere, dass es nicht gelungen ist, Brücken zwischen unterschiedlichen Schriftverständnissen zu bauen, damit alle – gut reformatorisch – ihrem in der Heiligen Schrift begründeten Gewissen folgen können und sich gleichgeschlechtlich liebende Menschen nicht länger diskriminiert sehen. Bei anderen Fragen gelingt uns dies ja, Brücken zwischen unterschiedlichen Schriftverständnissen und Gewissenfragen zu schlagen, etwa bei der Frage, ob man als Christ Soldat bei Bundeswehr sein kann oder nicht oder bei der Frage der Waffenlieferungen an die Ukraine. Solche Brücken zwischen konträren Positionen sind in unseren Zeiten wichtiger denn je.
Besonders will ich mich für die immer tragfähige Brücke, zwischen den Verfassungsorganen Synode, auch repräsentiert durch das Präsidium und Landesbischof bedanken. Vielen Dank für die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Synodalpräsidentin, mit Dir, liebe Sabine, und Euch, liebe Andrea und lieber Johannes. Die räumliche Nähe zwischen Bischofsbüro und Synodalbüro hat diese Zusammenarbeit befördert. Die kurzen Wege am Rotebühlplatz haben manche kurzen Absprachen erleichtert. Gut, dass diese kurzen Wege nun auch im Neubau gelebt werden können.
In einem war die 16. Synode anders als alle ihre Vorgängerinnen. Ich denke hier an die CoronaPandemie. Durch diese dramatischen Umstände waren wir alle extrem gefordert. Als Glückfall erwies sich, dass wir in der Landeskirche mit der digitalen Infrastruktur schon so weit waren. So konnten wir sehr viel digital bewältigen. Aber nicht nur die Gespräche am Rande fehlten. Vieles war komplizierter. So startete die Synode nach den Lockdowns gefühlt ein zweites Mal.
Corona hat die Synode auch nach den Lockdowns mehrfach beschäftigt: Im Aushandeln geeigneter Regeln mit Kommunen und Land, in Fürsorge für vulnerable Gruppen und in Konflikten zwischen Geimpften und Nichtgeimpften.
Die Synode habe ich da sehr verantwortungsbewusst erlebt, gerade weil die Coronakonflikte nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in Kirchengemeinden Narben hinterlassen haben. Manche Wunde konnte geheilt werden. Mit mancher Narbe müssen wir leben. Allerdings sollten wir uns nicht von Verschwörungsmythen leiten lassen. Natürlich wurden Fehler gemacht. Manche Entscheidung würden mit dem Wissen von heute sicher anders getroffen. Doch die damals Verantwortlichen haben so entschieden, weil sie Leben retten wollten und nicht, um die Bevölkerung zu „drangsalieren“.
Jede Synode sieht sich drängenden Herausforderungen gegenüber – nicht nur die jetzt zu Ende gehende 16. Landessynode. Vieles ist gelungen, ist abgearbeitet. Ich denke an die notwendige Veränderung unserer kirchlichen Strukturen. Der Aufbau der Regionalverwaltungen war ein großer Kraftakt, der im guten Austausch zwischen Synode und OKR geplant und beschlossen wurde. Ich hoffe, dass sich die Anlaufprobleme, die bei so großen Projekten unvermeidbar sind, jetzt nach und nach auflösen.
Ich denke aber auch an den PfarrPlan 2030. Trotz der schmerzhaften Einschnitte, die er für viele Kirchengemeinden mit sich bringt, wurde er letztlich im Konsens beschlossen. So auch das große Einsparpaket über 104 Millionen.
Hervorheben will ich auch das Klimaschutzgesetz, die vielfältige Agendenarbeit und nicht zuletzt als Konsequenz der Coronazeit die Ermöglichung des Abendmahls in digitaler Form.
Ein Thema, das niemals abgearbeitet ist, ist das Thema „Sexualisierte Gewalt in Kirche und Diakonie“. Hier sind wir in enger Abstimmung mit der EKD wichtige Schritte weitergekommen. Doch auch hier braucht es kontinuierliche Weiterarbeit in der Aufarbeitung und Prävention. Gut, dass dies unstrittiger Konsens in der Landessynode ist.
Daneben hat die Landessynode zahlreichen Gruppen, Einrichtungen und Partnerkirchen zu verstärkter Sichtbarkeit verholfen. Schließlich wurden erstmals mit dieser Landessynode Vertreter der internationalen Gemeinden als beratende Mitglieder zu den Synodaltagungen zugelassen.
Alles das wurde begleitet und unterstützt durch die besondere Kultur unserer Landessynode. Wo gibt es das sonst in einem Parlament, dass die Mitglieder nach Alter verteilt sitze? In einem langen Synodenleben rückt man Reihe für Reihe vor, sitzt neben Gleichaltrigen und vertritt Generationenanliegen. Diese Sitzordnung ist einfach bestechend.
Zu dieser Kultur gehört auch das Mittagsgebet. Auf der Höhe des Tages unterbricht es die mitunter hitzige Synodenarbeit und erinnert daran, dass wir in Christus miteinander verbunden sind und worin unser Auftrag besteht.
Miteinander verbunden sein in Christus, das ist die Basis für alle unsere Arbeit. Lasst uns daher einander versprechen, dass sich an dem fairen und wertschätzenden Ton bei Aussprachen auch zukünftig nichts ändert.
Die Synodenarbeit ist von dem Zusammenspiel der drei Verfassungsorgane unserer Landeskirche bestimmt: Landessynode, Oberkirchenrat und Landesbischof. Jedes dieser drei Organe hat spezifische Aufgaben und leistet einen wichtigen Beitrag für die Leitung unserer Landeskirche. Die besondere Zuordnung der drei Verfassungsorgane hat sich meiner Wahrnehmung nach sehr bewährt. Das ist der Rahmen, innerhalb dessen wir behutsam Strukturen und Zuordnungen überprüfen sollten. Der Transformationsdruck, dem auch unsere Landeskirche ausgesetzt ist, mahnt uns dazu.
Bei vielen kirchlich Hochengagierten – Ehren-, wie Hauptamtlichen – nehme ich Erschöpfung wahr. Das sollten wir ernst nehmen und uns fragen, wie echte Entlastung aussehen kann. Ich sehe die Landessynode da in einer Vorbildrolle.
Abschließend noch weinige, konkrete Anregungen, mit denen die Landessynode in aller Freiheit umgehen kann: Ich wünsche mir eine Synode, in der Abstimmungen auch jenseits der Gesprächskreisgrenzen normal werden.
Ich wünsche mir eine Synode, die auf ihren Tagungen keine Beschlüsse mehr nach 19:00 Uhr trifft. Ich wünsche mir eine Synode, in der Menschen mit Handicap über eine verbindliche Quote Sitz und Stimme haben. Ich wünsche mir eine Synode, die den Mut hat, kleiner zu werden und die Zahl ihrer gewählten Mitglieder reduziert. Ich wünsche mir eine Synode, die die Zahl ihrer Anträge an den Oberkirchenrat verringert.
Doch am Ende stehen nicht Wünsche, am Ende steht wie am Anfang der Dank! Der Dank für alle geleistete Arbeit, liebe Synodale. Einigen langgedienten Synodalen will ich aber noch namentlich danken.
Für drei Legislaturperioden – also 18 Lebensjahre – 14., 15. und 16. Landessynode
Ruth Bauer
Andrea Bleher
Matthias Böhler
Matthias Hanßmann
Anja Holland
Siegfried Jahn
Martin Plümicke
Steffen Kern (13. und 14. + 16.) – 15. pausiert
Und vier Legislaturperioden von der 13.-16. – also 24 Jahre Synode
Beate Keller
Euch allen: Vielen Dank für Euer großes und langejähriges Engagement für unsere Landeskirche und ein herzliches vergelts Gott.
(Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl)
Die vollständige Ansprache zum Downloaden finden Sie in der Klappbox oben: Dokumente zu Tagesordnungspunkt 36
Hier werden externe Inhalte des (Dritt-)Anbieters ‘Meta Platforms - Instagram’ (Zweck: Soziale Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit) bereitgestellt. Mit Aktivierung des Dienstes stimmen Sie der in unserer Datenschutzinformation und in unserem Consent-Tool beschriebenen Datenverarbeitung zu.
Beitrag auf Instagram
Hier werden externe Inhalte des (Dritt-)Anbieters ‘Facebook’ (Zweck: Soziale Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit) bereitgestellt. Mit Aktivierung des Dienstes stimmen Sie der in unserer Datenschutzinformation und in unserem Consent-Tool beschriebenen Datenverarbeitung zu.
Beitrag auf Facebook
Gottesdienst mit Abendmahl in der Stiftskirche
Alle Themen der Tagung
⬆️ Zum Seitenanfang
✳️Landessynode kompakt: Die wichtigsten Themen im Überblick
Alle Tagesordnungspunkte, Berichte und Dokumente:
- Grußworte
- Verabschiedung der Unabhängigen Kommission zur Gewährung von Leistungen in Anerkennung des Leids Betroffener sexualisierter Gewalt und Verleihung der Silbernen Brenz-Medaille an den Vorsitzenden Wolfgang Vögele
- TOP 01 Strategische Planung
- TOP 02 Planüberschreitungen und Jahresabschluss der landeskirchlichen Rechnung 2024
TOP 03 1. Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum landeskirchlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 mit Kirchlichem Gesetz - TOP 04 Trauung gleichgeschlechtlich liebender Ehepaare
- TOP 05
- TOP 06 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung und des Gottesdienstes anlässlich der Eheschließung (Beilage 145)
- TOP 07 Kirchliches Gesetz zur Ablösung des Diakonen- und Diakoninnengesetzes und zur Änderung des Württ. Pfarrergesetzes (Beilage 141)
- TOP 08 Kirchliches Gesetz zur Änderung von Dienstverpflichtungen (Beilage 140)
- TOP 09 Gottesdienstbuch für die Ev. Landeskirche in Württemberg, Zweiter Teil, Teilband Einführungen und Verabschiedungen
- TOP 10 Bericht über die Situation der verfolgten Christen in der Welt sowie der Menschen, die aus religiösen, rassistischen, politischen, ethnischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gründen unter Verfolgung leiden – Schwerpunkt auf Syrien, Kolumbien, Nigeria und Pakistan
- TOP 11 Berichte des Beauftragten für die Entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs und des Islambeauftragten
- TOP 12 Aktuelle Stunde
- TOP 13 Schlussbericht des Ausschusses für Mission, Ökumene und Entwicklung
- TOP 14 Schlussbericht des Finanzausschusses
- TOP 15 Schlussbericht des Ausschusses für Bildung und Jugend
- TOP 16 Änderung des Verwaltungsmodernisierungsgesetzes
- TOP 17 Folgeantrag Unvereinbarkeitsbeschluss Rechtsextremismus
- TOP 18 Bericht der Projektstelle für die Themen Rassismus und Antisemitismus/Populismus und Extremismus
- Bildergalerie:Impressionen der Herbsttagung
- TOP 19 Abschaffung der Aktuellen Stunde
- TOP 20 OIKOS und die AKSB
- TOP 21 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Mitarbeitervertretungsgesetzes (Beilage 142)
- TOP 22 Kirchliches Gesetz zur Änderung des Strukturerprobungsgesetzes (144)
- TOP 23 Kirchliches Gesetz zur Änderung der Kirchengemeindeordnung und weiterer Regelungen (Beilage 143)
- TOP 24 Schlussbericht des Rechtsausschusses
- TOP 25 Selbständige Anträge
- TOP 26 Förmliche Anfragen
- TOP 27 Schlussbericht des Ausschusses für Kirchen- und Gemeindeentwicklung
- TOP 28 Schlussbericht des Theologischen Ausschusses
- TOP 29 Abschlussbericht des Projekts „Geistlich Leiten, vom Geist geleitet“
- TOP 30 Schlussbericht des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der Schöpfung
- TOP 31 „Raum geben“ - Zwischenbericht zu den Projekten „Aufbruch Quartier“ und „Aufbruch Wohnen“
- TOP 32 Abschlussbericht des Projekts „Zukunftsgutscheine”
- TOP 33 Zwischenbericht zum Fonds „#miteinander“
- TOP 34 Schlussbericht des Ausschusses für Diakonie
- TOP 35 Schlussbericht des Sonderausschusses für inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte
- TOP 36 Abschluss der 16. Landessynode
- Gottesdienst mit Abendmahl in der Stiftskirche
Dokumente zum Gottesdienst
Abschlussgottesdienst in der Stiftskirche

Am Abend des letzten Sitzungstags feierten die Synodalen einen Abendmahlsgottesdienst, in dem Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl die Predigt über 1. Petrus 3, 15 hielt: „Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor Jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist.“
Landesbischof Gohl sagte mit Blick auf das Ende der Legislaturperiode: „Wir hören auf Gottes Wort und legen alles, was uns bewegt, in seine Hände. Wir kommen mit unserem Dank für vieles, was uns und anderen in den letzten sechs Jahren in der Synode gelungen ist. Und wir kommen mit dem Unfertigen und geben es Gott. Unfertig ist, was nicht besser gelungen ist. Pläne und Initiativen, die nicht Wirklichkeit geworden sind.“
Gohl stellte dann die christliche Hoffnung ins Zentrum seiner Predigt - und was geschieht, wenn die Hoffnung schwindet: „Christliche Hoffnung ist eine Grenzerfahrung. Wir leben in einer Welt der kleingewordenen Hoffnung. Und wenn Menschen keine Hoffnung haben, träumen sie sich in vergangene Zeiten zurück. Rückzug und Abschottung sind die Folge. Kein Wunder, dass diese politischen Kräfte grad weltweit im Aufschwung sind.“
Mit einem Blick auf die kommende Legislaturperiode der 17. Landessynode sagte Gohl, niemand wisse, „wie die Kirche in sechs Jahren aussehen wird. Aber unsere Berechnungen, Erfahrungen und Analysen gehen von einer kleiner werdenden Landeskirche aus, deren Finanzmittel weiter zurückgehen werden“. Deshalb müsse sich „die Arbeit der Kirche noch konsequenter als bisher an ihrem Auftrag der Evangeliumsverkündigung in Wort und Tat orientieren. Dabei spielt die Zeugenschaft des einzelnen Christen eine immer größere Rolle.“
In einer „Welt des Krieges, der Macht des Stärkeren, voller Gleichgültigkeit und ohne Poesie, bedroht von Ignoranz, Hass und Gleichgültigkeit, kommt es auf jeden und jede von uns an: Lasst uns die unendliche Größe dieser Hoffnung, die unsere gemeinsame Hoffnung ist, bezeugen!“
Im Folgenden lesen Sie die Predigt von Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl im Volltext:
Liebe Schwestern und Brüder!
Es gute Tradition in unserer Landeskirche, dass nach der letzten Sitzung der Landessynode ein gemeinsamer Gottesdienst gefeiert wird. Wir hören auf Gottes Wort und legen alles, was uns bewegt, in seine Hände. Wir kommen mit unserem Dank für vieles, was uns und anderen in den letzten sechs Jahren in der Synode gelungen ist. Und wir kommen mit dem Unfertigen und geben es Gott. Unfertig ist, was nicht besser gelungen ist. Pläne und Initiativen, die nicht Wirklichkeit geworden sind.
Als wir vor sechs Jahren zur konstituierenden Sitzung der neugewählten 16. Landessynode zusammenkamen, da war der Blick natürlich nach vorne gerichtet. Viele wollen ihre Herzensthemen voranbringen, haben große Ideen für eine gute Zukunft unserer Kirche. Direkt gewählte Synodale haben ein starkes Mandat und eine große Verantwortung für ihren Wahlkreis und das Ganze der Synodalarbeit. Viele kommenden Herausforderungen waren absehbar, andere, wie die Folgen der Coronazeit, waren völlig unerwartet.
Der heutige Gottesdienst mit seiner Abendmahlsfeier gibt uns Raum und Gelegenheit, diesen Vorhaben und Erfahrungen der letzten sechs Jahre noch einmal nachzugehen und mit allem, was gelungen ist oder eben nicht gelungen ist, Frieden zu schließen. Dabei leitet uns ein Bibelwort aus dem 1. Petrusbrief, dass bereits am Beginn der gemeinsamen Synodalarbeit vor sechs Jahren Landesbischof July ausgelegt hat. In 1. Petr 3,15 heißt es:
„Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor Jedermann,
der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist“.
Mit diesem Bibelwort ist es wie mit unserem Glauben. Der Glaube beginnt nicht mit einem Auftrag, sondern mit einer Zusage: „Ihr habt Grund zur Hoffnung!“
Gleich am Anfang nennt der Apostel den Grund der Hoffnung. Es ist die Auferstehung Jesu Christi. Sie ist die Mitte unserer christlichen Hoffnung.
Der Tod hat nicht das letzte Wort. Das letzte Wort hat das neue Leben. Die Auferstehung Jesu Christi ist der Beginn eines „neuen Himmels“ und einer „neuen Erde“, wie es im letzten Buch der Bibel heißt. Diese Hoffnung trägt uns durch die tiefen Täler in unserem Leben und unserer Welt jenseits von Eden. Und diese Hoffnung ist in unseren Zeiten wichtiger denn je.
Die Hoffnung, die in uns ist, hat einen Grund und ein Ziel. Der auferstandene Christus ist der Grund. Die Auferstehung von den Toten ist das Ziel. Und, liebe Geschwister, die Hoffnung, die in uns ist, hat eine Weite. Es ist die Hoffnung, die nicht allein in mir ist, sondern in uns allen.
Auf der Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes 2023 in Krakau war die enorme Kraft, die in dieser gemeinsamen Hoffnung steckt, mit Händen zu greifen. „One Body. One Spirit. One Hope.“, war sie überschrieben. Christinnen und Christen aus allen Erdteilen teilten in Krakau ihre ganz persönliche Hoffnung. Diese Hoffnung steckte nicht nur an. Sie schöpft aus dem „neuen Himmel“ und der „neue Erde“ und weitet unseren Blick über die Erfahrung der Gegenwart hinaus.
Christliche Hoffnung ist eine Grenzerfahrung. Wir leben in einer Welt der kleingewordenen Hoffnung. Und wenn Menschen keine Hoffnung haben, träumen sie sich in vergangene Zeiten zurück. Rückzug und Abschottung sind die Folge. Kein Wunder, dass diese politischen Kräfte grad weltweit im Aufschwung sind. Doch Rückzug und Abschottung lösen in unserer globalisierten Welt keine Probleme, sondern verschärfen sie.
Die Christen und Christinnen, an die der Apostel im 1. Petrusbrief schreibt, zeigen wie es anders geht: Sie ziehen sich nicht zurück. Als kleine Minderheit leben sie in einer Gesellschaft, die mit dem christlichen Glauben und seiner Hoffnung nichts oder nur wenig anfangen kann. Auch wir in Württemberg sind mit dem christlichen Traditionsabbruch konfrontiert. Aber wir erleben auch, wie groß unsere Möglichkeiten nach wie vor sind, in die Gesellschaft hineinzuwirken. Bei meinen Besuchen in den Gemeinden und Bezirken erlebe ich immer wieder Bürgermeister, Landräte, Schulleiterinnen und Unternehmerinnen, die die Zusammenarbeit mit der Landeskirche sehr wertschätzen und erhalten wollen. Gerade die Landessynodalen sind hier besonders wichtige Kontaktpersonen. Deshalb ermutige ich Sie alle, diese wichtige Vernetzungsarbeit auch in Zukunft fortzusetzen.
Niemand von uns weiß, wie die Kirche in sechs Jahren aussehen wird. Aber unsere Berechnungen, Erfahrungen und Analysen gehen von einer kleiner werdenden Landeskirche aus, deren Finanzmittel weiter zurückgehen werden.
Deshalb muss sich die Arbeit unserer Kirche noch konsequenter als bisher an ihrem Auftrag der Evangeliumsverkündigung in Wort und Tat orientieren. Dabei spielt die Zeugenschaft des einzelnen Christen eine immer größere Rolle. Im Grunde bringt es die Präsidentin der Lutherischen Kirche in Taiwan, Laura Chan auf den Punkt. Sie sagt über Christen in Taiwan: „Die Christen in Taiwan lesen die Bibel. Und die übrigen Menschen in Taiwan lesen die Christen“.
Das meinen die Worte aus dem 1. Petrusbrief:
„Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor Jedermann,
der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist“.
Liebe Schwestern und Brüder!
Durch Euer öffentliches Amt in der Landessynode habt Ihr in den vergangenen sechs Jahren Rechenschaft gegeben von der Hoffnung, die in uns ist: Jesus Christus. Durch Gottesdienste und Andachten. Durch die Synodenarbeit in den Fachausschüssen, in der Verantwortung in der Landessynode, in der Arbeit in den kirchlichen Einrichtungen, Kirchenbezirken und Gemeinden. Die Landessynode und ihre Mitglieder haben sich in zahlreichen Verlautbarungen, Beschlüssen und Gesetzen zu drängenden gesellschaftspolitischen Fragen geäußert und immer wieder über den Glauben nachgedacht.
Daher will ich Ihnen und Euch von Herzen für diese Dienste danken. Und mit diesem Dank verbinde ich die Erinnerung des 1. Petrusbriefs an die Tragweite unsere Hoffnung:
In einer Welt des Krieges, der Macht des Stärkeren, voller Gleichgültigkeit und ohne Poesie, bedroht von Ignoranz, Hass und Gleichgültigkeit, kommt es auf jeden und jede von uns an: Lasst uns die unendliche Größe dieser Hoffnung, die unsere gemeinsame Hoffnung ist, bezeugen!
Doch der Glaube beginnt nicht mit einem Auftrag, sondern mit einer Zusage: Für alle Aufgaben, die vor uns liegen, lassen wir uns durch Gottes Wort stärken und am Tisch des Herrn lassen wir alles hinter uns, was uns in der Vergangenheit von Gott und unseren Mitmenschen getrennt hat.
So sind wir bereit zur Verantwortung vor Jedermann, der von uns Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in uns ist.
Amen.
Die Predigt finden Sie in der Klappbox oben: Dokumente zum Gottesdienst