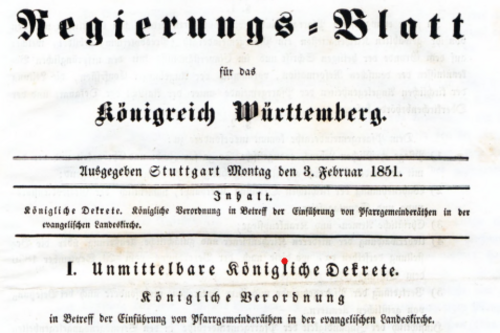4. Juni 1875: 150. Todestag von Eduard Mörike

Bewundernswert die Geduld, die der Evangelische Oberkirchenrat – das Konsistorium – einst mit dem Theologen Eduard Mörike hatte. Entweder war Mörike Dauervikar oder wegen Krankheit beurlaubt. Und das von 1828 bis 1834, als er am 20. Mai zum Pfarrer in Cleversulzbach berufen und bereits 1843 auf eigenen Wunsch in den einstweiligen Ruhestand versetzt wurde.
Eduard Mörike wurde am 8. August 1804 in Ludwigsburg geboren. Weil er ein Cleverle war, konnte er bis 1822 das Seminar in Urach besuchen. 1826 bestand er das Theologische Examen als Tübinger Stiftler. In seinem Zeugnis wurde ihm bescheinigt, dass er über „ziemlich mangelhaftes, dennoch keineswegs zu verachtendes Wissen“ verfüge. Seine Leidenszeit im kirchlichen Dienst (er nannte es „Vikarsknechtschaft“) begann als Vikar in Oberbohingen, Möhringen und Köngen. 1828 ließ er sich beurlauben, um ab 1829 als Pfarrverweser in Pflummern und Plattenhardt zu wirken. Dann war er wieder Vikar in Owen, Pfarrverweser in Eltingen und Ochsenwang, Weilheim/Teck, dann wieder in Owen und Ötlingen. 1834 endlich seine erste Pfarrstelle in Cleversulzbach – es war auch seine letzte, immer wieder unterbrochen durch krankheitsbedingte Beurlaubungen.
Lieber Schreiben als Seelsorgen
Mörikes Berufung lag woanders. Er wurde in der deutschen Literaturgeschichte zur Brücke zwischen Romantik und Realismus. Seine Gedichte wurden vertont und machten ihn sogar in Europa bekannt.
Seine Bandbreite reichte von der Novelle “Lucie Gelmeroth”, über den Roman “Maler Nolte” bis zur Oper “Die Regenbrüder”. In das Herz der Schwaben schrieb er sich mit „Das Stuttgarter Hutzelmännchen“, darin enthalten „Die Historie der schönen Lau“. Unvergessen auch sein Gedicht „Der alte Turmhahn“ über den Kirchturmgockel von Cleversulzbach. Seine Übersetzungen griechischer Lyrik haben heute noch Geltung.
Sein Beziehungsleben war ein permanentes Scheitern. Schon zu Lebenszeiten jedoch fand sein literarisches Schaffen Beachtung. 1851 begann er mit dem Unterricht der Literatur am Katharinenstift in Stuttgart, 1852 wurde er Ehrendoktor der Universität Tübingen. Ende Mai 1875 versöhnte er sich wieder mit seiner Frau. Am 4. Juni starb er. Am 6. Juni wurde er auf dem Pragfriedhof in Stuttgart beerdigt.
Eduard Mörike war ein Genie. Vielleicht hat der Evangelische Oberkirchenrat das frühzeitig erkannt und mit seiner unendlichen Geduld in Personalangelegenheiten ihn passend gewürdigt.
Jürgen Kaiser